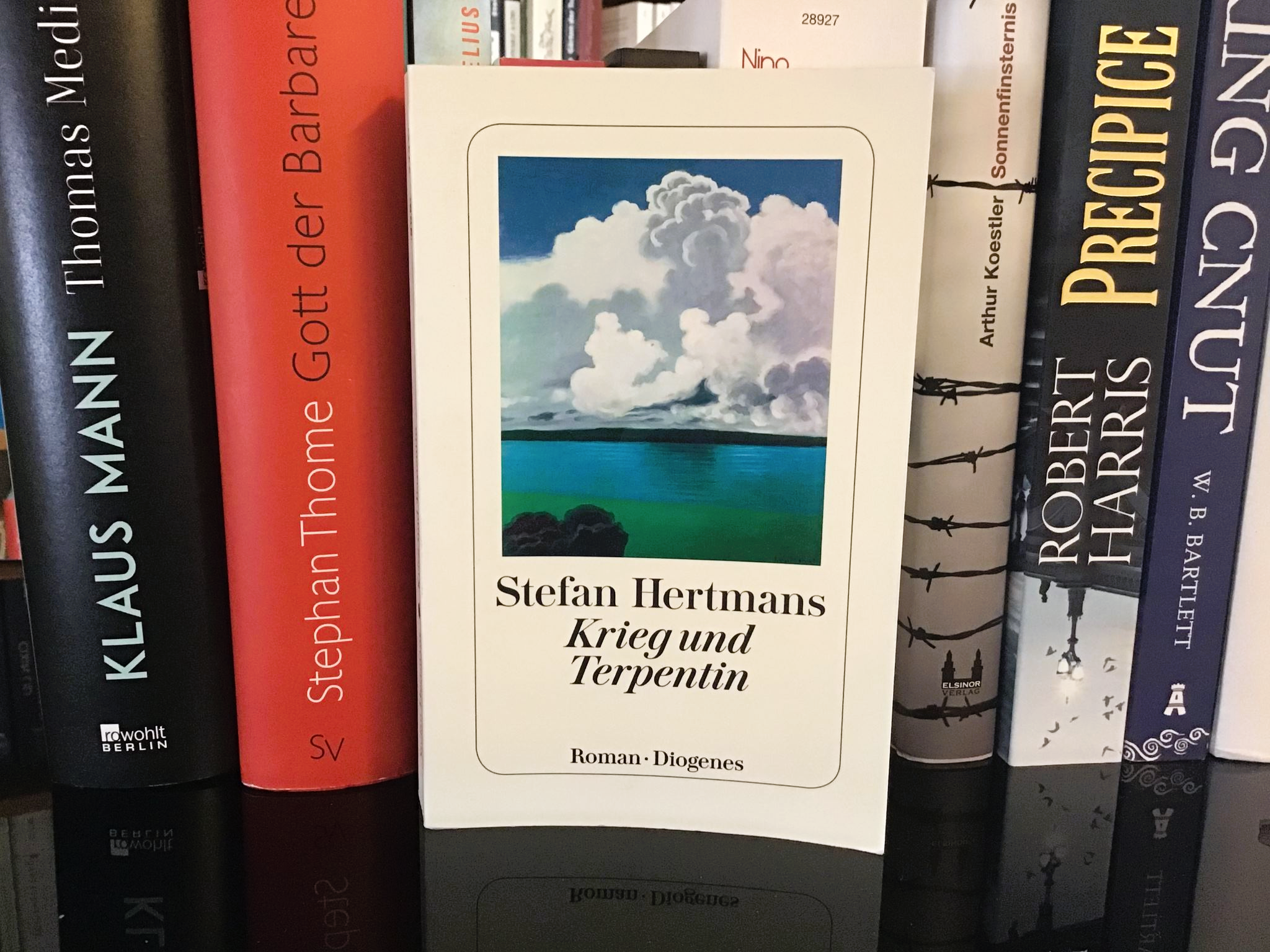Als Kind bekam ich ein Hörspiel geschenkt: Hannibal. Erzählt wurde von einem der spektakulärsten Feldzüge der Geschichte, der Zug eines karthagischen Heeres einschließlich einiger Kriegselefanten über die Alpen, um Rom zu besiegen. Viele Aspekte, die das Hörspiel vermittelte, werden in der historischen Forschung längst nicht mehr vertreten, einige sind bis in die Gegenwart umstritten. Für mich war es der Beginn des Interesses an Geschichte, einschließlich dem, was man Antike nennt.
Der Ausgangsort von Hannibals Unternehmen war Hispanien, wie das Land in Geschichte Spaniens in der Antike von Pedro Barceló genannt wird. Die Antike endet in diesen Buch erst mit der Errichtung des Kalifats von Cordoba. Lange Zeit galt das formale Ende des (West-)Römischen Reichs 475 n. Chr. als Schlusspunkt antiker Geschichte, was in vielerlei Hinsicht problematisch ist.
Diese eher schlichte und willkürliche Datierung kappt Kontinuitäten wie die Goten-Herrschaft in Spanien, von der fast ein Jahrtausend fortgeschriebenen römischen Geschichte in Gestalt von „Byzanz“ ganz zu schweigen. Allein aus diesem Grund ist das Buch sehr zu begrüßen, es eröffnet in vielerlei Hinsicht eine neue Perspektive auf ein Hispanien, das später zur weltumspannenden Großmacht und noch später beliebtem Reiseland wurde.
So brauchte das übermächtige Rom, die größte Militärmacht des Altertums, schließlich zwei Jahrhunderte, um die Gesamtheit des flächenmäßig beträchtlichen, widerborstigen Landes zu erobern.
Pedro Barceló: Geschichte Spaniens in der Antike
Die Karthager haben Hispanien nach ihrer ersten Niederlage gegen Rom aus dem Halbschatten ins geopolitische Rampenlicht geholt. Bemerkenswert, wie stark verflochten die Mittelmeerwelt bereits war, während die ansässigen Stammesverbände ganz unterschiedlicher Herkunft (Iberer, Kelten, Tartessaner etc.) gleichzeitig recht abgeschlossen lebten.
Ausgerechnet diese Zersplitterung machte es später den Römern so schwer, Hispanien gänzlich zu erobern, da es keine Möglichkeit für umfassende Vereinbarungen mit den Besiegten gab. Dem Sieg über die Karthager folgten schier endlose Kriege, die massive Rückwirkungen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in Rom hatten und mit dazu beitrugen, die Republik zu destabilisieren.
Naturgemäß sind die Möglichkeiten, etwas über die Einwohner Hispaniens vor der römischen Zeit mangels aussagekräftiger Quellen begrenzt. So gibt es zwar ein iberisches Alphabet, das immer noch Rätsel aufgibt, was die Bedeutung der entschlüsselten Worte anbelangt. Hinter dem Schleier des Unwissens liegen zumindest keine „Völker“, sondern – wie in Germanien – locker gefügte Stammesverbände mit einer dynamischen Zusammensetzung.
Die Saguntaffäre war zunächst eine binneniberische Angelegenheit.
Pedro Barceló: Geschichte Spaniens in der Antike
Die schriftlichen Quellen aus römischer Zeit (karthagische gibt es dank der vernichtenden Niederlage nicht) nehmen eine entsprechende Sicht von außen auf Hispanien ein. Es ist ein Schauplatz und die dort Lebenden sind oft auf eine Statisten– oder Zuschauerrolle reduziert, während sich der karthagisch-römische Konflikt, die Eroberung und Romanisierung des Landes entfaltet.
Das kann den Blick auf wichtige Aspekte verstellen, etwa die Wurzeln des Kampfes um Sagunt. Barceló legt die Ereignisse so aus, dass Sagunt, eine mit Rom verbündete Stadt, ihre hispanischen Nachbarn mit Krieg überzog. Die angegriffenen Turboleten waren jedoch mit den Karthagern verbunden, die vor der Wahl standen, zugunsten ihrer Klientel einzugreifen oder zurückzustecken und Rom das Feld zu überlassen. Eine geradezu klassische geostrategische Zwickmühle.
Nicht nur im Hinblick auf die Kriegsursache, die von vielen modernen Historikern und allen römischen Quellen verzerrt dargestellt und ausgewertet wurde, erzählt Geschichte Spaniens in der Antike die Ereignisse auf eine andere Weise. Der gesamte Kriegsverlauf wird nicht – wie üblich – vor allem auf den italischen Schauplatz fokussiert, sondern auf den spanischen. Hier sei die Entscheidung gefallen, meint Barceló und nennt bedenkenswerte Gründe, unter anderem hinsichtlich der Kriegsfinanzierung durch die hispanischen Bodenschätze.
Nach der Niederlage im Teutoburger Wald 9 n. Chr. wurden die Expansionspläne unter Tiberius seit 14 n. Chr. bald aufgegeben nicht nur weil die militärischen Abenteuer des Oberbefehlshabers Germanicus zu riskant sondern wohl vor allem in der Bilanz zu wenig ertragreich waren das Land war schlicht zu arm an Ressourcen um mit der Beute die aufwendigen Militärausgaben zu kompensieren die ihre Eroberung erfordert hätte.
Pedro Barceló: Geschichte Spaniens in der Antike
Besonders gelungen ist die Einordnung der Ereignisse und ihrer Folgen, etwa durch Vergleiche. In Spanien führten die Römer viele Jahrzehnte Krieg bis zur Unterwerfung, in Gallien brauchte Caesar nur weniger Jahre, während Germanien nach der ersten großen Niederlage aufgegeben wurde. Vor allem aber bildete Hispanien Hand in Hand mit dem römischen Krieg gegen Karthago den Anfang eines tiefgreifenden innerrömischen Wandels, an dessen Ende die Republik blutige Bürgerkriege und schließlich ins Prinzipat unter Augustus mündete.
Wie so oft bei der Beschäftigung mit antiker Geschichte berührt die Darstellung grundlegende Fragen. Die innerrömischen Veränderungen zementierten eine kleine Oberschicht, die sich mittels militärischer Unternehmungen und Expansion des Herrschaftsgebietes profilierte und in Form gnadenloser Auspressung der erworbenen Gebiete schamlos bereicherte. Zum Preis tausender Toter Legionäre wurden immer neue Kriege vom Zaun gebrochen, Verträge geschlossen und ignoriert sowie gewaltige Vermögen angehäuft.
Das Verhängnis nahte – verkürzt gesagt – in Gestalt zu großer Vermögen, daraus resultierender militärischer und politischer Macht und einer Gesetzgebung, die sozialen Aufstieg erschwerte. Nun ist Geschichte trotz aller Pfadabhängigkeit immer offen, die römische Gesellschaft musste nicht zwangsläufig untergehen, was sie trotz aller Krisen auch über Jahrhunderte nicht tat. Auch verbieten sich direkte Rückschlüsse oder gar Gleichsetzungen für die Gegenwart. Es sind vielmehr die Fragen, die sich aus der Beschäftigung mit der überlieferten Geschichte ergeben, die einen großen Wert darstellen.
Geschichte Spaniens in der Antike von Pedro Barceló ist in der Historischen Bibliothek der Gerda Henkel Stifung bei C.H. Beck erschienen. Für das Rezensionsexemplar bedanke ich mich herzlich.
Pedro Barceló: Geschichte Spaniens in der Antike
C.H.Beck 2025
Gebunden 492 Seiten
ISBN: 978-3-406-82898-0