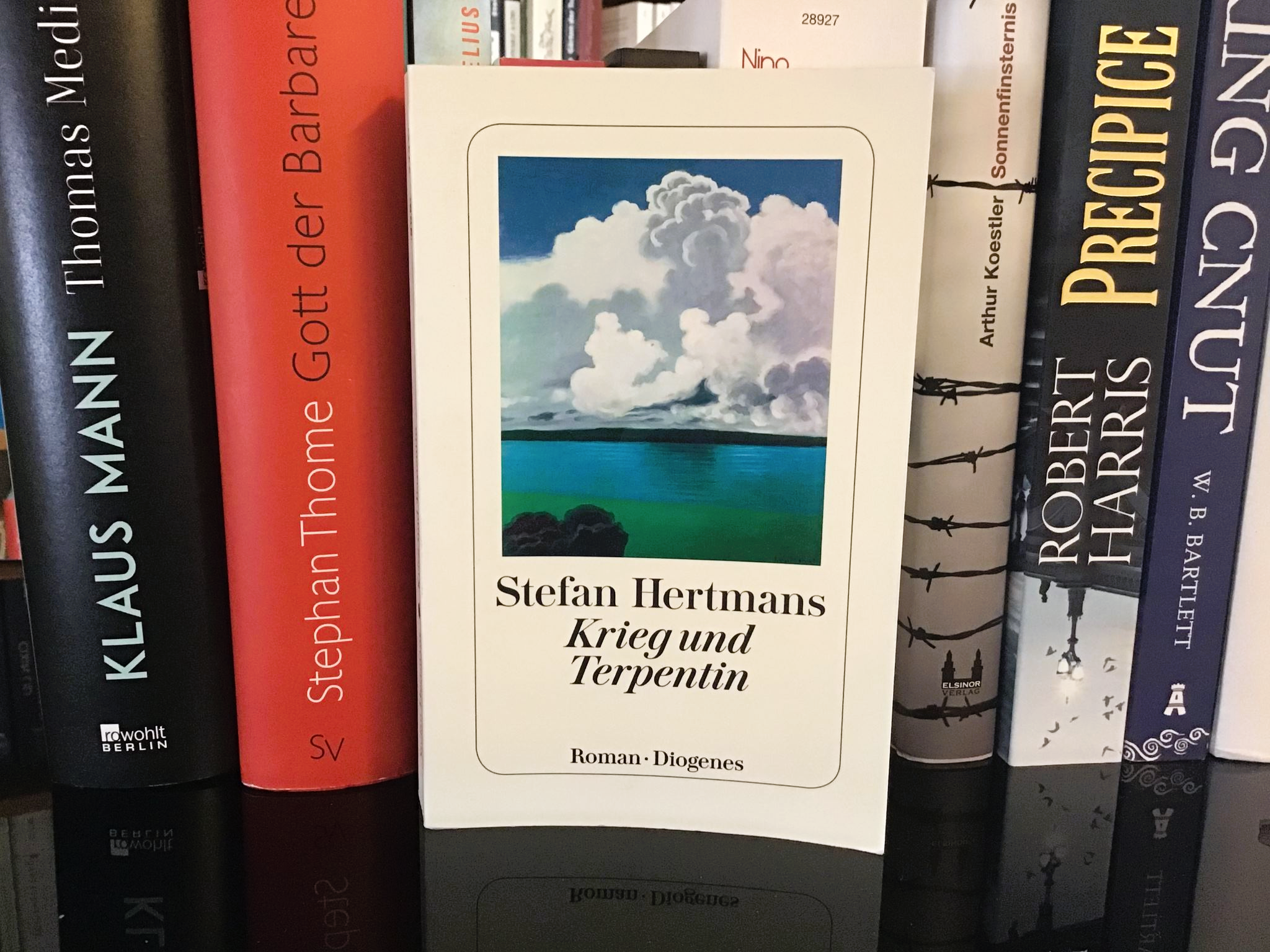Bernd Greiners Sachbuch gehört zu dem Interessantesten, was ich in diesem Segment bislang gelesen habe. Zugleich ist die Lektüre so unangenehm gewesen wie selten. Die Kriegführung der USA in Vietnam wird auf einigen Ebenen mit sachlicher Erbarmungslosigkeit seziert und vorgeführt. Unter dem Strich ist das Versagen der mächtigsten Nation der Welt in Vietnam zutiefst erschütternd und niederschmetternd.
Wie weitreichend das Desaster gewesen ist, verdeutlicht ein Zitat des Amerikaners Telford Taylor, der Anfang der 1979er Jahre in seinem Buch Nürnberg und Vietnam sagte:
Wir haben es irgendwie nicht geschafft, die Lektionen zu lernen, die wir in Nürnberg lehren wollten, und genau dieses Versagen ist die Tragödie des heutigen Amerika.
Telford Tayler, Nürnberg und Vietnam
Das Zitat bildet den Schlusssatz von Krieg ohne Fronten. Ein sehr passend gewählter, denn der Bezug zu dem Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg drängt sich während der Lektüre mehrfach auf. Im Kern des Buches steht die atemberaubend brutale Kriegführung der US-Armee (und ihrer Verbündeten).
Da Greiner es nicht dabei belässt, sondern ausführlich schildert, auf welchen strukturellen, personellen, politischen und militärischen Rahmenbedingungen diese beruht und zugleich beleuchtet, wie im Nachgang mit den (Un-)Taten umgegangen wurde, wird deutlich, warum Vietnam bis heute eine Blackbox ist und auch bleiben wird: Vertuschung, Umdeutung, Hetze gegen Aufklärer usw. verhinderten, dass Kriegsverbrechen der US-Armee überhaupt ans Licht kamen.
Damals wie heute sind die Überbringer schlechter Nachrichten, die Enthüller, die Mutigen, die sich dem Morden entgegenstellten, viel stärker das Ziel von Anfeindungen gewesen als die Täter.
Unter dem Strich bekommt der Leser einen Eindruck davon, warum Abu Ghraib keine allzu große Überraschung gewesen ist und die Kriege im Irak und Afghanistan gescheitert sind. Es wäre an der Zeit, darüber nachzudenken, warum die Victory–Culture und der Exzeptionalismus auch fünfzig Jahre nach Vietnam fröhliche Urstände feiern, wenn der letzte militärische Sieg bald achtzig Jahre zurückliegt.
Erwähnt sei noch, dass die Vietcong und ihre Untaten keineswegs unerwähnt bleiben, ebensowenig die desaströsen politischen, sozialen und gesellschaftlichen Umstände in Südvietnam. Greiners Buch ist auch in dieser Hinsicht umfassend und streitbar.
Bernd Greiner: Krieg ohne Fronten
Die USA in Vietnam
Hamburger Edition 2009
Broschur 596 Seiten,
67 Abb., 4 Karten
ISBN 978-3-86854-207-3