
Seit Jahresanfang baue ich meine Arbeit als Schriftsteller und Buchblogger um. Der Prozess ist noch im Gange, er begann schon 2024 und wird noch einige Zeit andauern. Mehr als drei Jahre habe ich in beiden Bereichen viele Erfahrungen gesammelt und einiges ausprobiert, natürlich immer wieder Veränderungen vorgenommen, Formate angepasst und erweitert oder zusammengestrichen.
Ein Umbau reicht weiter als eine Veränderung. So habe ich mich in den vergangenen zwölf Monaten von Facebook und Zombie-Twitter (aka »X«) auf Nimmerwiedersehen verabschiedet, das hochgehandelte Threads ist der nächste Kandidat. Dort habe ich alle Postings, Antworten und Likes gelöscht, da nicht alle interessanten Leute dort auch auf BlueSky aktiv sind, bleibe ich passiv einstweilen dort. Meine Accounts bei Goodreads und Lovelybooks habe ich ebenfalls gelöscht.
Aktiv bleibe ich nur bei BlueSky und mit Abstrichen Mastodon, hinzu kommt ein drastisch verringertes Engagement auf Instagram. Dort schreibe ich gelegentlich eine Kleinigkeit auf meinem Schriftsteller-Account, außerdem kurze Versionen zu Büchern für meinen Blog-Account. Die hektische Jagd nach Reichweite, zu der Metas Algorithmen antreiben, ignoriere ich einfach.
Die Arbeit füllt die Kassen eines höchst fragwürdigen Unternehmens mit abstoßenden Methoden, die Vorteile für mich sind minimal bis nicht messbar. Ich freue mich über das Interesse an Büchern, deren Lektüre mir gut gefallen hat oder die mir wichtig sind. Aber wie misst man eigentlich? Aufrufe und Likes sind kein Interesse, ein höchst flüchtiges Medium wie Instagram und Text schließen sich im Grunde genommen aus.
Für meine Schriftstellerei sind die Internet-Plattformen defacto bedeutungslos. Auch wenn Marketing-Profis etwas anderes behaupten, in meinem Fall gibt es nur marginale Buchverkäufe via SoMe. Zur so genannten »Buchbubble« gehöre ich glücklicherweise nicht, neben brauchbaren Tipps und Anregungen gerade zu Beginn meines Weges als notgedrungener Selbstpublizierer stößt man dort auf viel gedankenlosen Unsinn und die überall anzutreffenden menschlichen Abgründe.
Das Internet wandelt sich durch so genannte Künstliche Intelligenz massiv. Wenn Suchergebnisse, die auch jetzt schon problematisch genug sind, durch KI-Antworten ersetzt oder verwandelt werden, wird sich die virtuelle Realität noch weiter von der Wirklichkeit entfernen, Manipulation und weitere Konzentration werden voranschreiten. Wer ein wenig mit KI herumspielt, macht irgendwann die Erfahrung, wie grotesk vieles ist, was die Software ausspuckt.

Schon jetzt ist es so, dass Internet gleichbedeutend mit Internet-Plattformen (aka »Soziale Medien«) gebraucht wird. Der Surfer hält sich vorwiegend dort auf. Was ist aber mit dem Rest? Konkret: Was ist mit meinem Blog? Kann das alles weg? Möglicherweise. In meinem Fall bleibt es allerdings dabei, dass das Bloggen über Bücher zum Teil meines Lesens geworden ist. Ausgelesen habe ich ein Buch oft erst dann, wenn ich mich damit schriftlich auseinandergesetzt habe. Die Blog-Beiträge sind immer auch Ausdruck meines Zugangs zum Buch. Ich betreibe keine Literaturkritik.
Da es absurd wäre, jedes Buch auf diese Weise zu verarbeiten (wozu auch?), fokussiere ich mich auf wenige, die es wert sind, dass ich mich mit einem ausführlichen Blogbeitrag damit auseinandersetze. Parallel will ich mehr Ressourcen ins Schreiben stecken, phasenweise auch sämtliche mir zur Verfügung stehende Zeit. Dem wird nun der Blogmonat zum Opfer fallen, der in dieser Form hier das letzte Mal erscheint. Ob und wie ich das Format, das beliebteste auf meinem Blog, ersetze, weiß ich noch nicht.
Die Juli-Bücher kurz vorgestellt
Was für ein herausragender Historischer Roman! Stephan Thome hat mit Gott der Barbaren von einem »War on Drugs» ganz anderer Art erzählt. Statt mit Gewalt den Strom von Drogen in das eigene Land zu stoppen, versuchten die Briten im 18. Jahrhundert China zu zwingen, Opium ins Land zu lassen. Während der US-Krieg gegen die Drogen ein Fiasko ist, hatten die Briten letztlich Erfolg. Thomes Roman schildert aus mehreren Perspektiven den Gang der Dinge, es ist beeindruckend, wie er die drei miteinander kämpfenden Fraktionen und ihre Weltsicht darlegt, die alle anderen faktisch ausschließt, dennoch von Zweifeln, offenen Fragen und zum Teil grotesken Widersprüchen geprägt ist. Neben dem offiziellen China und den Briten gibt es noch die Aufständischen, die versuchen, ein Paradies auf Erden zu errichten. Mit sattsam bekannten Nebenwirkungen, wie die Hauptfigur zu spüren bekommt. Ein deutscher Missionar, ehemals 1848er Demokrat auf der Flucht, wird in den Strudel hineingezogen, der Millionen das Leben kostet. Der Gott der Barbaren, der Christengott, ist Teil des Desasters. Einer der besten historischen Romane, die ich je gelesen habe.
Militärgeschichte ist keineswegs nur ein Thema für »Waffennarren und Lehnstuhlfeldherren«. Sie ist ein wesentlicher Teil der allgemeinen Geschichte und gemessen an ihrem Einfluss auf den Gang der Dinge hierzulande eher stiefmütterlich behandelt und wahrgenommen. Stig Förster nimmt sich in seiner voluminösen Darstellung einem halben Jahrtausend deutscher Militärgeschichte an. Explizit stellt er sie in den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang, nimmt Bezug auf andere Segmente der Geschichte, wenn sie etwas beizutragen haben. Deutsche Militärgeschichte* soll dabei kein Handbuch und erst recht kein Lexikon sein, sondern einem breiten Publikum einen Zugang zum Sujet verschaffen. Wie man sich denken kann, muss es naturgemäß Verkürzungen und Fokussierungen geben, doch das kann man getrost inkauf nehmen. Die längsschnittartige Behandlung der Militärgeschichte fördert interessante Erkenntnisse und manchmal auch regelrechte Glanzpunkte zutage. Parallelen und Unterschiede werden sichtbar, langfristige Trends und ihre Brüche. Mit Blick auf die Gegenwart ist Deutsche Militärgeschichte ein wichtiges Rüstzeug für die Auseinandersetzung mit einem überlebenswichtigen Thema. Das Buch ist Teil der von mir sehr geschätzten Historischen Reihe der Gerda-Henkel-Stiftung.
Große Geister, und doch auch kleinkarierte Kreaturen. Überspitzt formuliert, aber der Jenaer Freundeskreis, der sich vor der Jahrhundertwende in der kleinen Universitätsstadt zusammenfand und daranging, das »Ich« in die Welt zu entlassen, gebärdete sich auch reichlich bodennah gemessen an ihren hochfliegenden Worten, Ideen und Gedankengebilden. Andrea Wulf lässt in ihrem Buch Fabelhafte Rebellen auch diese eher profanen, zänkischen, von Eifersucht und Eitelkeit getriebenen Seiten nicht aus. Auf einem Sockel finden sich die Schlegels, Novalis, Fichte und wie sie alle heißen nicht wieder, was die Herrschaften umso lebendiger macht. Ohnehin muss man sagen, dass trotz einiger Ausnahmen mit den Frauen quasi die Hälfte der Menschheit von allem »Ich«- und Freiheitsgedröhn ausgeschlossen war, die Nöte des gewöhnlichen Volks schienen in diese Sphären gar nicht zu gehören. Für mich war die Lektüre hochspannend, die Schaffensweise und gegenseitige Stimulanz etwa von Schiller und Goethe ist ganz wunderbar geschildert, auch die politische Großwetterlage (Napoleon) rumpelt und grollt lange im Hintergrund. Am Ende weckt der Blick in die Zeit und Lebensumstände das Bedürfnis, zu den Klassikern zu greifen und zu lesen.
Zu den großen Stärken des Romans Blue Skies von T.C. Boyle gehört sein konsequent umgesetzter, kommentarloser Stil, in dem er seine Figuren in einer Welt handeln lässt, die von der Erderhitzung heimgesucht wird. Nur wenige Personen agieren an wenigen Orten. Die Personen sind sämtlich bemerkenswert makelbehaftet, was identifikatorisches Lesen fast unmöglich macht. Boyle lotet einen beträchtlichen Teil der menschlichen Abgründe aus. Als europäischer Leser muss man mit direkten Übertragungen vorsichtig sein. Gesellschaftliche Konventionen, der Umgang und das Life-Style der US-Gesellschaft stehen im Fokus, die Klima-Katastrophe ist eher eine aktive Kulisse. Kurios, dass alle einfach weitermachen, sich in Teilen anpassen, ohne eine grundsätzliche Änderung der Lebensweise vorzunehmen. Manche Dinge sind seltsam: Inmitten harscher Wasserknappheit ist der Pool noch gefüllt, die Spülmaschine läuft ununterbrochen, trotz langer Stromausfälle. Ungereimtheiten, die übertroffen werden vom Romanende, mit dem ich hadere. Ein Natur-Elysium (als Hoffnungsschimmer?). Ausgerechnet ein Milliardär sorgt für Abhilfe, was mich schweratmend zurücklässt.
Der Tanz hatte für die Zeit der Weimarer Republik eine ganz besondere Bedeutung, wie Thomas Medicus in seiner vorzüglichen Biographie über Klaus Mann dargelegt hat. Dessen Erstling hieß nicht umsonst Der fromme Tanz. Mit diesem Wissen habe ich den Roman Der ewige Tanz von Steffen Schroeder gehört, dessen Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor mir ausgesprochen gut gefallen hat. Mit dem neuen Roman nähert sich Schroeder der berühmten und tragisch früh verstorbenen Tänzerin und Schauspielerin Anita Berber an. Die Handlung folgt ihrem Lebensweg, dessen Ende durch die geschickte Struktur der Erzählung vorweggenommen ist. Früh wird klar, wie verhängnisvoll die Mutter Anita Berbers ihrer Tochter gegenübergestanden hat, ein kleines Postkärtchen ans Sterbebett lässt in einen schwarzen Abgrund aus egozentrischer Missgunst blicken. Angenehm ist der Stil Schroeders, der Distanz hält und keine Nähe vorgaukelt, dabei aber einen unverstellten Blick hinter die Kulissen wirft. Ebenso wunderbar sind die vielen Begegnungen, die Anita Berber macht, wie immer bleibt das Bedauern, dass alles für die Katz war, als die Nazis kamen.
Gleich zwei Bücher aus der von mir sehr geschätzten Historischen Bibliothek der Gerda Henkel-Stiftung habe ich im Juli ausgelesen. Der Historiker Pedro Barceló beschäftigt sich mit Spanien oder Hispania in der Antike, er spannt einen weiten Bogen von den Ursprüngen bis zum Beginn des Kalifats. Geschichte Spaniens in der Antike* bietet eine neue Perspektive auf bereits Bekanntes aus der Römischen Geschichte, mit überraschenden Einsichten. So wird der dramatische wie für den Aufstieg Roms zur Weltmacht entscheidende Krieg gegen Karthago nicht auf den italischen Boden fokussiert, sondern auf Hispania. Hannibals Scheitern in Italien hing einmal mit den Erfolgen Roms auf der iberischen Halbinsel zusammen, zum zweiten wurde dort die Grundlage für den Sieg gelegt und zwar auf wirtschaftlicher Basis. Die nachfolgende, schier endlose Eroberung der Halbinsel wirkte sich wiederum direkt auf die römische Innenpolitik aus, mit tiefgreifenden Folgen. Insgesamt ist der Band sehr gut lesbar, von einzelnen Passagen abgesehen, wie dem Anfang, wenn die in Hispania lebenden Stammesgruppen aufgelistet werden. Darüber sieht man jedoch gern hinweg.
Die Handlung des wohl berühmtesten Films von Fritz Lang, Metropolis, spielt 2026, also kommendes Jahr. Was für eine perfekte Gelegenheit, sich diesen Film (und vielleicht noch andere) einmal anzuschauen. Wer Fritz Lang eigentlich war, wie sein Lebensweg von der Malerei zur Regie führte, wie sich sein Schaffen in der Zeit der Weimarer Republik parallel zum Aufstieg des Nationalsozialismus entwickelte, erfährt man in der Graphic Novel von Arnaud Delalande / Éric Liberge. Die Bilder sind grandios und ausdrucksstark. Die Rolle, die Thea von Harbou für Fritz Lang gespielt hat, wird ebenfalls deutliche, sie hat die Drehbücher für die großen Filme geschrieben und war einige Jahre Langs Geliebte und Ehefrau. In der Graphic-Novel leben sich beide unter anderem durch ihr unterschiedliches Verhältnis zum Nationalsozialismus auseinander, folgerichtig verlässt Land 1934 das Reich, während Thea dort bleibt. Thema ist auch der Tod von Langs erster Frau, offiziell ein Unfall, inoffiziell Mord. Die Graphic Novel lässt das letztlich offen, während die Hauptperson in Steffen Schroeders Der ewige Tanz, Anita Berber, von Mord ausgeht.
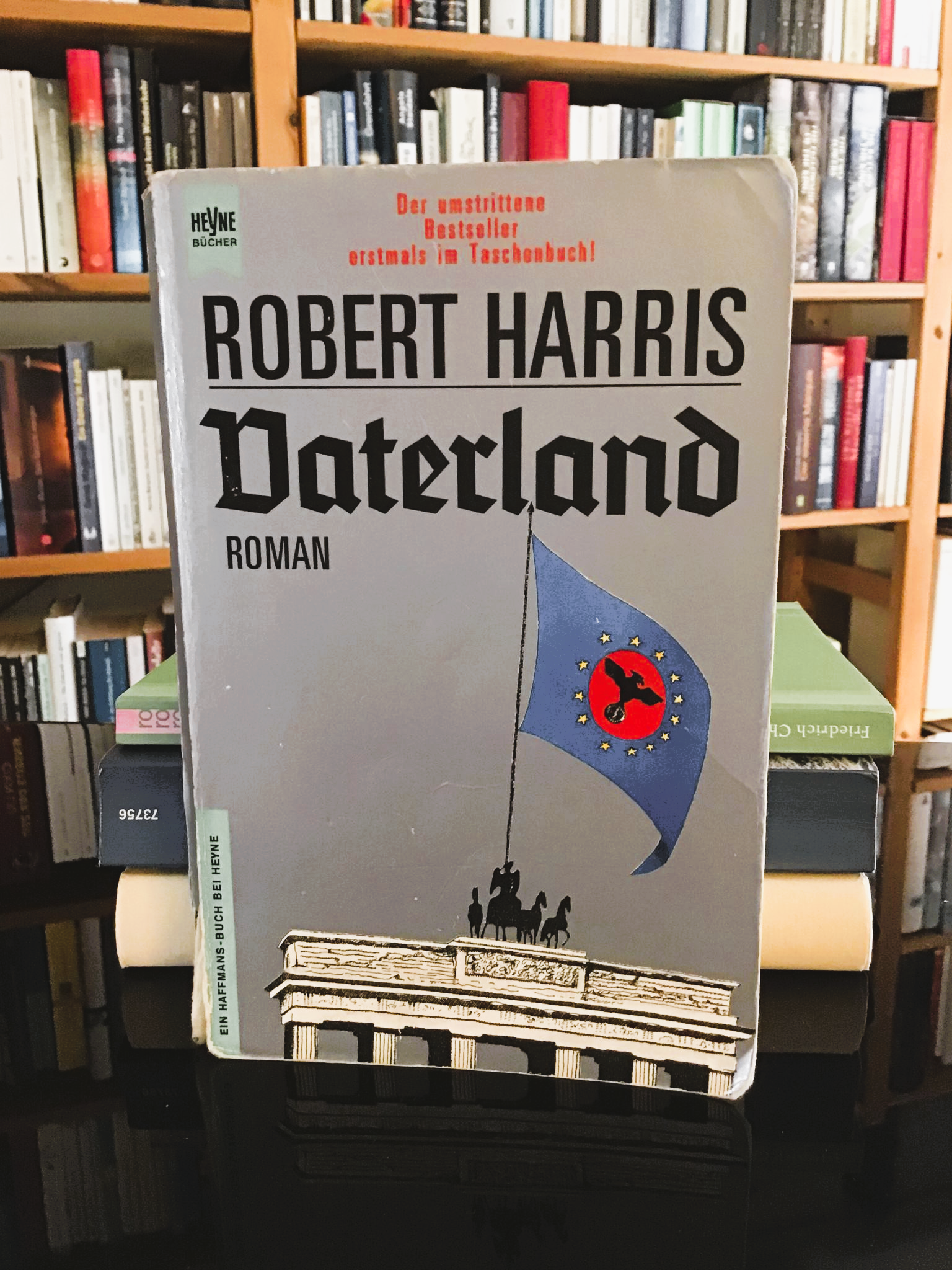



Schreibe einen Kommentar