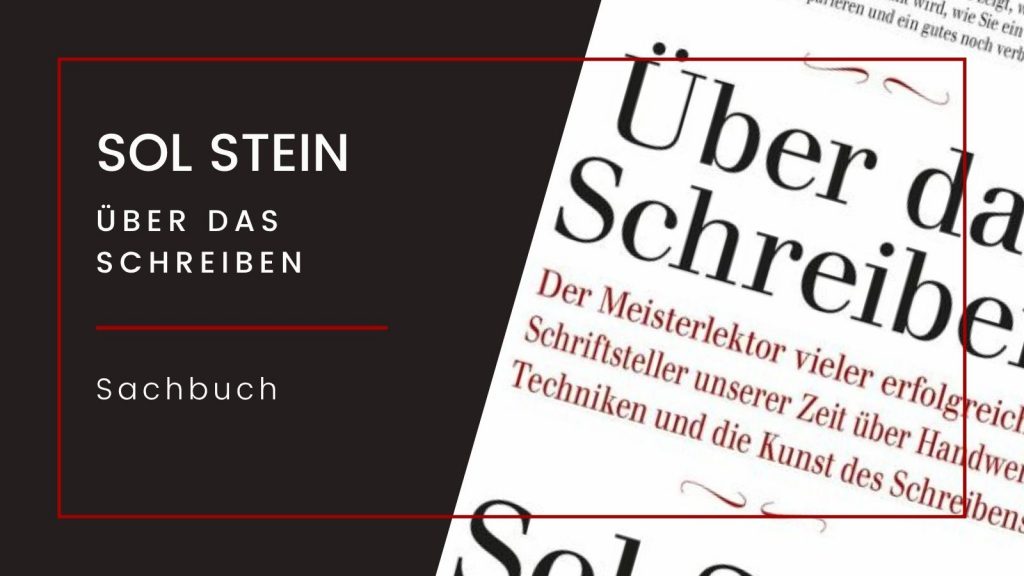
Als Autor über das Buch eines „Meisterlektors“ kritisch zu urteilen, hat etwas Anmaßendes. Das gilt insbesondere, wenn der Autor nur ein armer Selbstveröffentlicher ist, dem es nicht vergönnt war, einen Verlag für seine Manuskripte zu finden. Für „Meisterlektor“ Sol Stein ist das aber eines der wesentlichen Kriterien des Erfolgs, der (Verkaufs-)Erfolg ist der alleinige Leitstern seiner Arbeit. Schreiben, um möglichst vielen Lesern zu gefallen, sie mit „Spannung“ zu fesseln, ist wenig überraschend der Rote Faden durch sein Buch. Gefälligkeitsliteratur soll es sein.
Entsprechend sind die Textbeispiele von Stein ausgewählt, denen gemeinsam ist, dass sie oft von erschütternder Schlichtheit sind. Amerikanische Massenware, jene aufgeblasen wirkende, narzisstisch um sich selbst drehende Art des Erzählens, die oft konstruiert wirkt, künstlich. Dieses Urteil erlaube ich mir durch den Vergleich zu den Textbeispielen, die Michael Maar für sein vorzügliches Buch Die Schlange im Wolfspelz ausgewählt hat. Das Niveau der Textstellen ist dort fast immer großartig, bei Stein selten. Der „Meisterlektor“ greift auch auf seine eigenen Werke als Textfundus zurück, was bisweilen peinlich wirkt. Maar verzichtet zum Glück darauf; ebenso auf „Tipps“.
Sol Steins Selbstbewusstsein touchiert nicht selten die Grenze zur Hybris. Der Eindruck drängt sich auf, hier meine jemand, den Schlüssel für die Kunst des Schreibens tatsächlich in den Händen zu halten. Der Autor tritt oft belehrend wie ein weiser Schulmeister auf. Seine Ratschläge an den »unerfahrenen Autor« lesen sich oft wie Moses’ in Stein gemeißelte Gebote, die befolgt werden müssen. Doch gilt für Schreibtipps wie für Börsentipps: Man sollte ihnen niemals blind folgen. Zum einen gibt es von berufener Seite andere Ansichten zu diversen Punkten. James Wood vertritt in Die Kunst des Erzählens die Haltung, dass Figuren nicht zwangsweise »Tiefe« haben müssen.
Wer Über das Schreiben aufmerksam liest, findet immer wieder Fragwürdiges. Ein Beispiel, das sich mit dem Thema »Zeigen statt Erzählen« befasst, soll das verdeutlichen. Die Auslegung der Textstelle finde ich nicht recht nachvollziehbar.
Hinter dem Polarkreis ist die Farbe der Kälte Blau. Aber in der Tiefe der arktischen Gewässer ist die Farbe der Kälte Schwarz.
Sol Stein: Über das Schreiben
Stein sieht in diesen beiden Zeilen einen tollen Romanbeginn, dem ich nur zustimmen kann. Auch kann ich den Eindruck des Geheimnisvollen nachempfinden, fühle aber auch etwas Bedrohliches in dem Buchbeginn. Was ich nicht verstehe, ist Sol Steins Begründung dafür, wie diese Stelle funktioniert.
Wir sehen das Wasser vor uns. Und der Farbwechsel hat etwas Geheimnisvolles.
Sol Stein: Über das Schreiben
Welches Wasser? Im ersten Satz ist gar nicht von Wasser die Rede, im zweiten nur mittelbar, denn das Wasser ist in der Tiefe so wenig schwarz wie das an der Oberfläche. In beiden Sätzen geht es um das Licht und eine Empfindung (Kälte), also um etwas, das man nicht sehen kann. Die Empfindung soll verdeutlicht werden durch die bildhafte Übertragung auf die Farbe des Lichtes bzw. dessen Abwesenheit in der Tiefe der See. Man kann das Wasser in der absoluten Dunkelheit gar nicht sehen, es kann nicht »gezeigt« werden; es wird erzählt/behauptet. Der scharfe Kontrast zwischen beiden (Licht-)Welten erzeugt den Eindruck des Geheimnisvollen, sogar Bedrohlichen, denn Licht ist die Voraussetzung für Leben; seine Abwesenheit deutet auf den Tod hin.
Als Über das Schreiben 1995 erschien, war von KI noch nicht die Rede. Bei der Lektüre dreißig Jahre später drängt sich die Frage auf, ob Algorithmen, die entlang der Wahrscheinlichkeiten kalkulieren, die Anweisungen Steins nicht viel besser, also leserbefriedigender und erfolgreicher erfüllen können, als jeder Mensch. Aber wer ist eigentlich mit »Leser« gemeint? Mit Literatur im Sinne meines Leseinteresses – denn das bin ich ja auch: ein Leser – hat das alles nichts zu tun. Auch Sol Steins Unterstellungen, was »Leser« allgemein mögen oder nicht, sind im Wortsinne erstaunlich eingeschränkt. Man ist auf sehr schmaler Spur unterwegs in Sol Steins Lese-Welt.
Die meisten Bücher, die ich im Leben gelesen habe, wären in Steins Lektoren-Welt gar nicht erschienen. Das liegt auch daran, dass der „Meisterlektor“ eine Inhaltsorientierung von Autoren als problematisch betrachtet. Für ihn zählt weniger, was der Autor zu erzählen hat, sondern was sein »Leser« konsumieren will. Das allein ist kurios genug, vor allem aber sind fast alle Textbeispiele zu Steins „Handwerk“ in ihrer Wirkung auf den Leser abhängig vom Kontext. Den aber bestimmt oft genug insbesondere der Inhalt. Wenig überraschend würde sich die Wirkung fast aller Textbeispiele in Über das Schreiben abhängig vom Inhalt verändern, was den Gehalt der Aussagen Steins abschwächt.
Aber auch jene Aspekte, die ich kritisch sehe, regen zum Nachdenken an. Das hat bekanntlich noch niemandem geschadet und so habe ich das Buch mit Gewinn gelesen. Als Leser und Blogger kann ich nun treffender beschreiben, was mich an Büchern (us-amerikanischer Autoren) stört; jüngste Beispiel wären Blue Skies von T.C. Boyle oder Das große Spiel von Richard Powers, aber auch Lincoln Highway von Amor Towels.
Für meine eigene Arbeit als Autor bietet Über das Schreiben Anregungen zum Nachdenken bei der Überarbeitung des Manuskriptes. Anregend ist etwa der Abschnitt über Rückblenden und die Vermeidung von gehäuftem Plusquamperfekt. Anregend ist auch die Drehbuch-Methode der Actors-Studios. Steins zutreffende Ansichten zu Liebesszenen sind (avant la lettre) vernichtend für jede Form von Romance-Büchern. In einem Punkt, der für das Schreiben von elemtarer Bedeutung ist, kann man Sol Stein unumwunden zustimmen:
Am Widerwillen, das einmal Geschriebene zu überarbeiten, erkennt man im allgemeinen den Amateur.
Sol Stein: Über das Schreiben
Sol Stein: Über das Schreiben
Autorenhaus Verlag 2015
Hardcover 464 Seiten
ISBN: 9-783-8-66711266
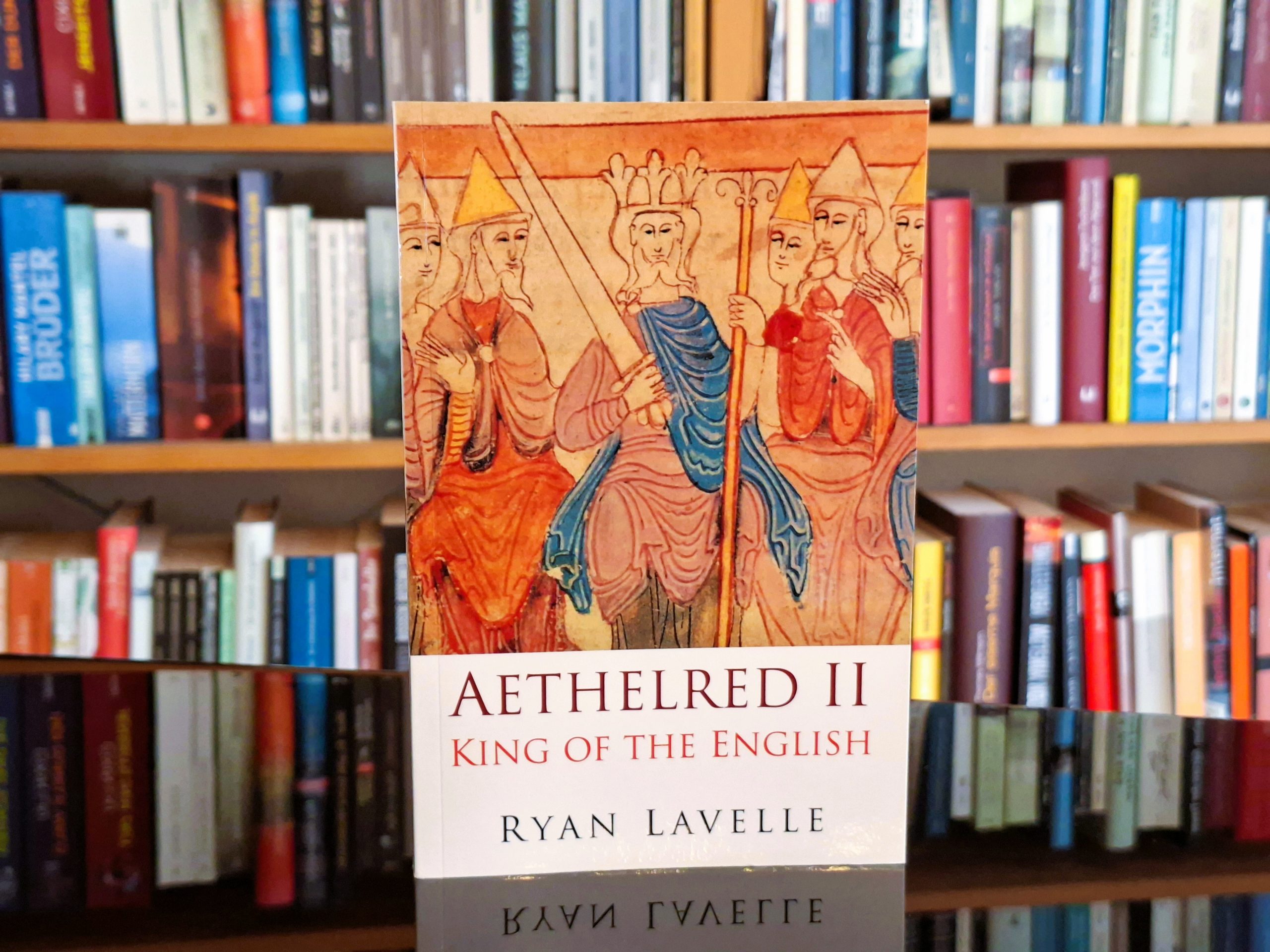
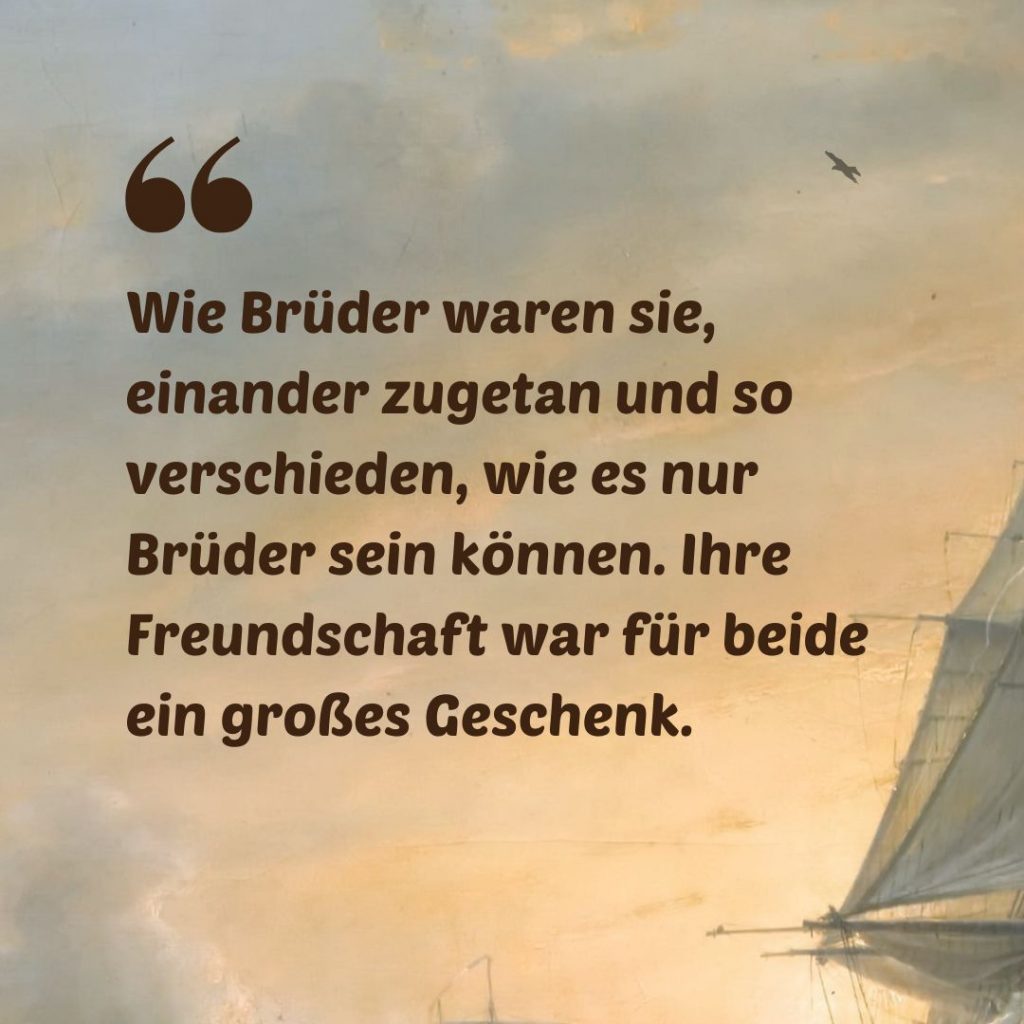
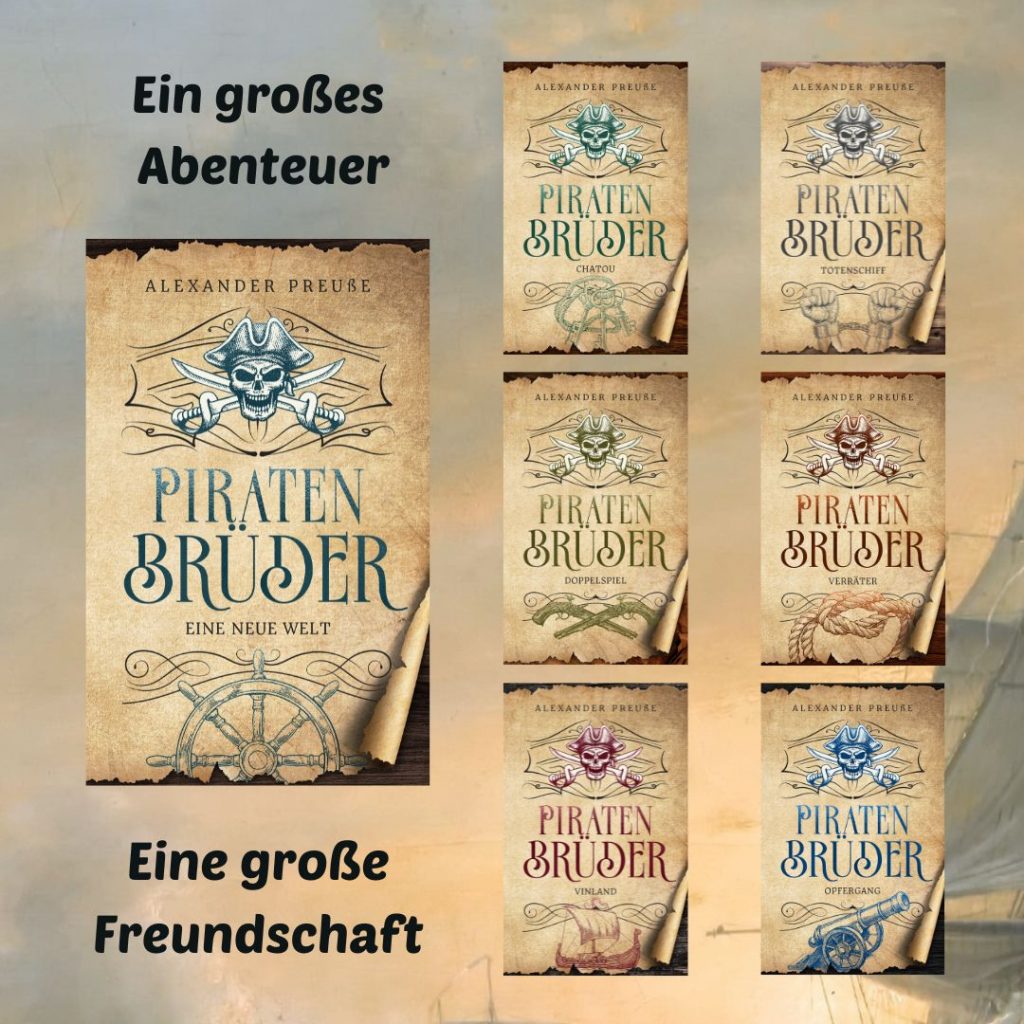


Schreibe einen Kommentar