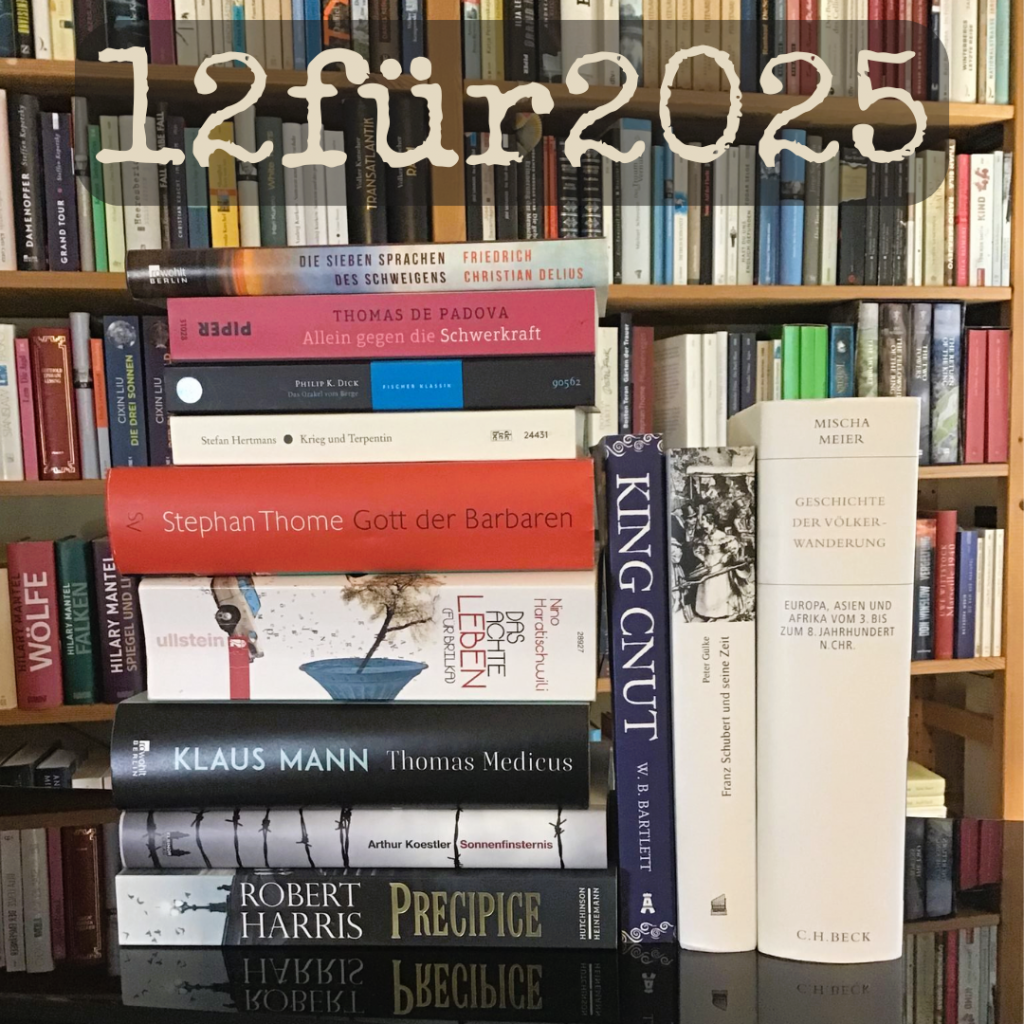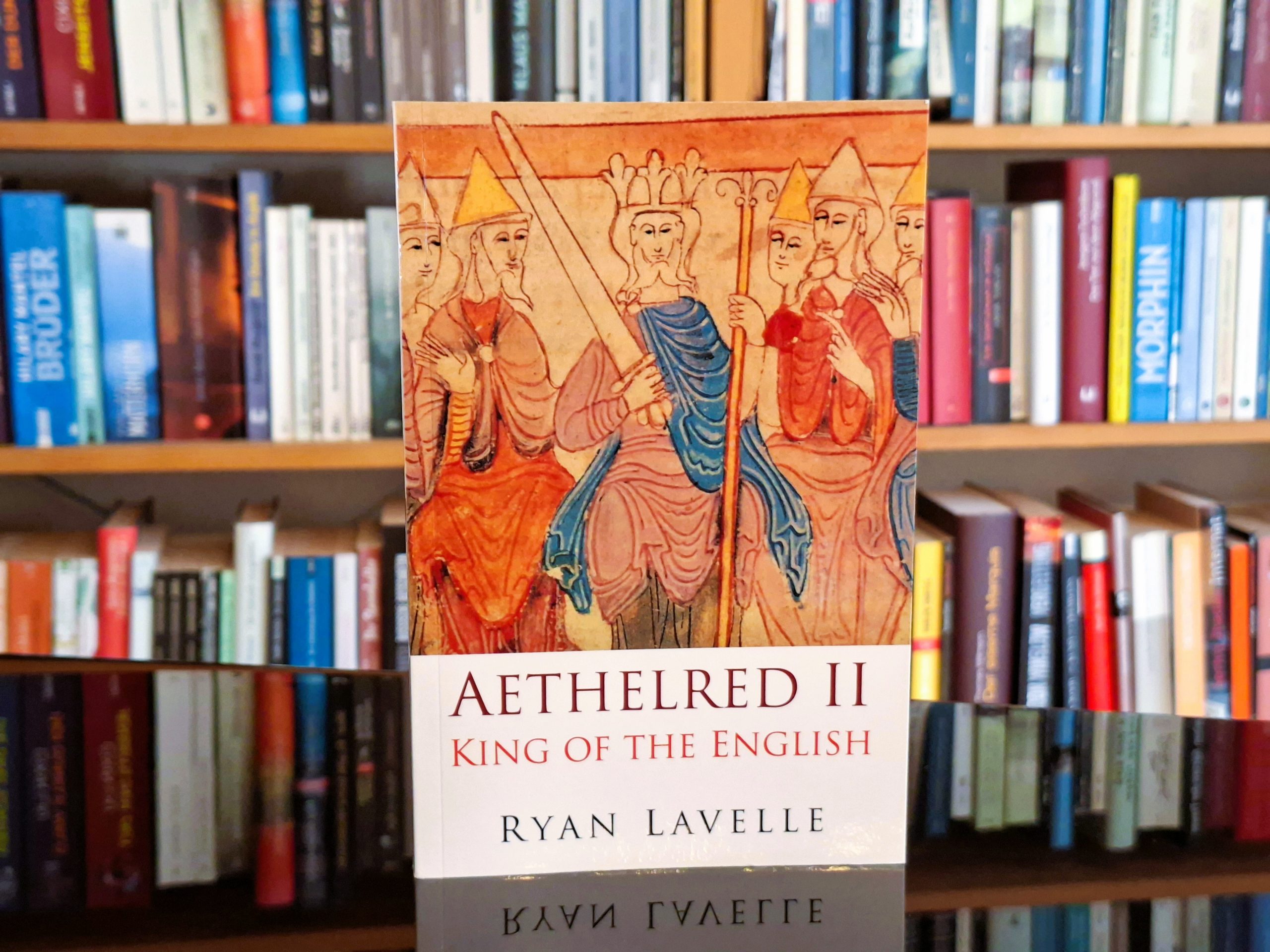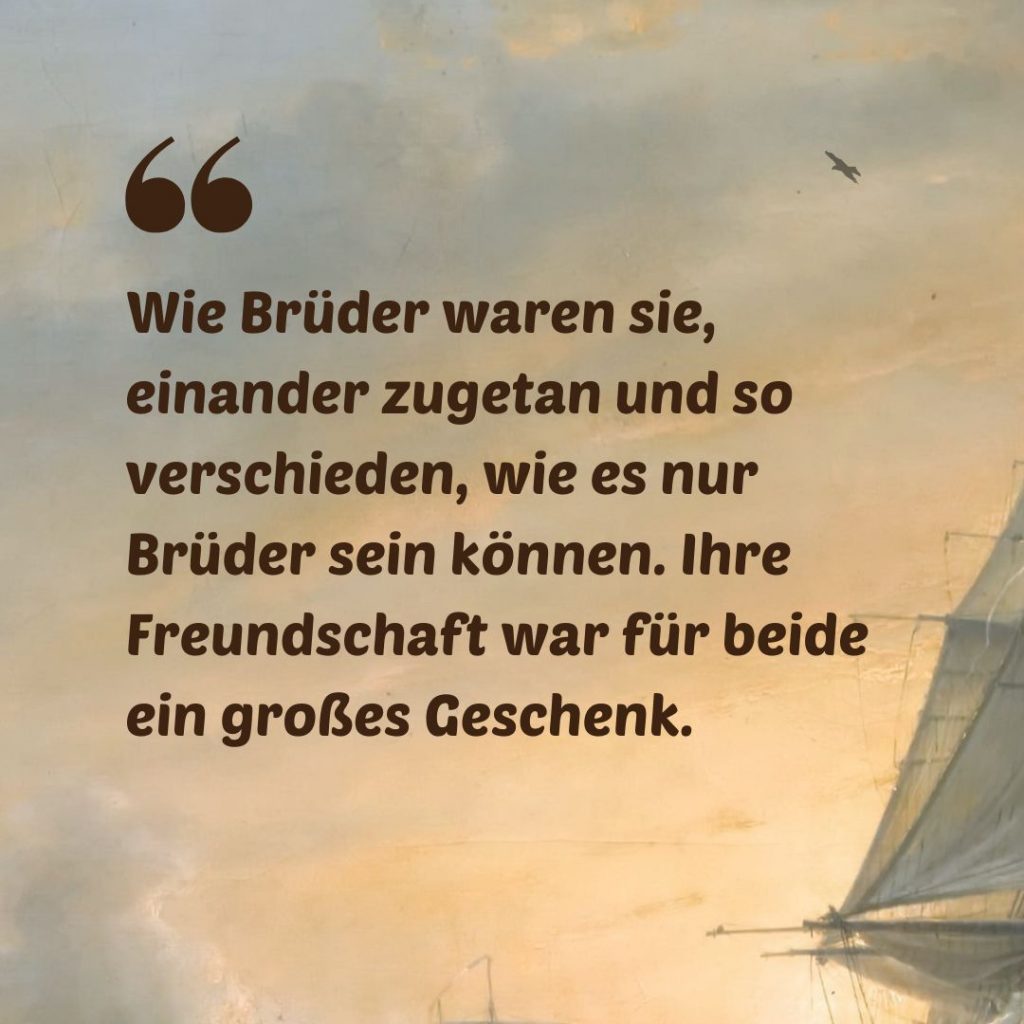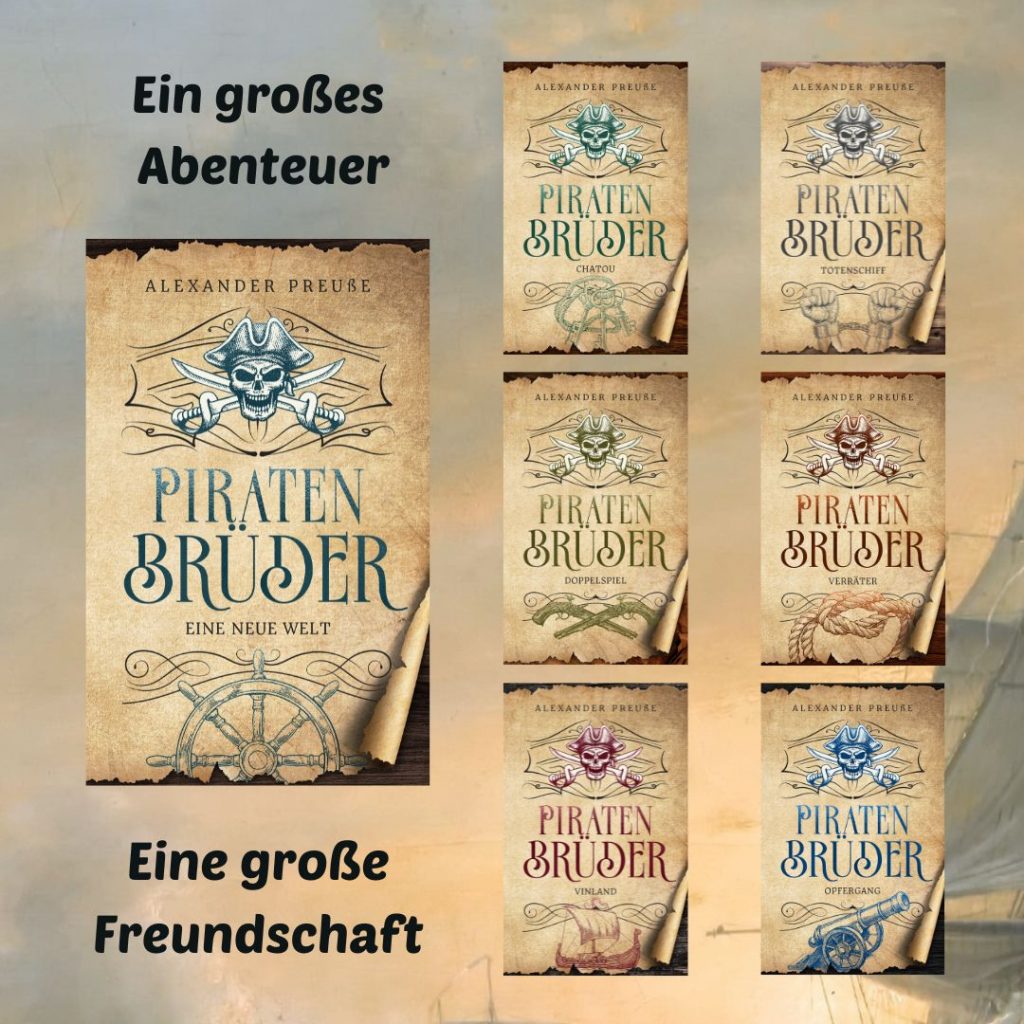Zwei überväterliche Großschriftsteller an einem Tag, das war wohl zu viel für den ewigen Sohn.
Thomas Medicus: Klaus Mann
Todessehnsucht und Drogenmissbrauch gehörten zu den Wegbegleitern von Klaus Mann. Die Biographie von Thomas Medicus beginnt folgerichtig mit dem Ende, dem Suizid am 21. Mai 1949. Es war nicht der erste Anlauf, dem Leben mit einem Freitod ein Ende zu setzen, gar nicht zu reden von den zahllosen Gedanken an den Tod, der ewigen Sehnsucht nach dem Tod.
In seinen 42 Lebensjahren zwischen 1906 und 1949 erlebte Klaus Mann die dramatischen Brüche der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1914, 1918 und insbesondere 1923 prägten ihn, der damit zur so genannten Kriegsjugendgeneration zählt. Die ihnen attestierten Attribute, Härte, Kühle, Verschlossenheit, Durchsetzungsfähigkeit waren Klaus Mann aber völlig fremd.
Gerade in den zwanziger Jahren lebte der Sohn des berühmten Thomas Mann und Neffe von Heinrich Mann auf schnellem, großem Fuß, sein natürlicher Lebensraum war die Großstadt, Theater, Amüsement, Clubs, Partys, Ausschweifungen, Sex, Alkohol, später immer mehr Drogen. Auftritte vor Publikum, auf der Bühne als Schauspieler oder Autor, der Hang zur Selbstinszenierung. Ein Dandy in perfekt sitzenden Anzügen, der sich bald als Dauerbewohner von Pensionen und Hotels durchs Leben schlug, immer in Geldnöten, oft alimentiert von seiner Mutter.
Die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war eine Epoche auf Messers Schneide. Es gibt Menschen, die ein Zeitalter deshalb verkörpern, weil sie dessen Höhen und Tiefen, Irrrungen und Wirrungen, vor allem Gefährdungen bis in die letzte Faser durchleben wie durchleiden. Klaus Mann ist so eine Symbolfigur.
Thomas Medicus: Klaus Mann
Klaus Mann war hochsensibel, sehr verletzlich, fiel als Homosexueller aus dem gesellschaftlich als Norm akzeptierten Rahmen, insbesondere, weil er – anders als sein Vater – aus seinen homoerotischen Neigungen keinen Hehl machte. Zudem stand er als ewiger Sohn unter immensem Druck, ein Wettlauf als Schriftsteller mit dem übermächtigen Vater, den er nicht gewinnen konnte.
Dabei schrieb Klaus Mann mit großer Leichtigkeit und immenser Geschwindigkeit seine Werke. Biograph Medicus verweist darauf, dass die Detailarbeit, das prüfende Feilen und Durchforsten der Bücher, nicht zu den Stärken des Autors gehörten. Ihnen haftet oft etwas Flüchtiges an. Stoffe wie Alexander oder Sinfonie Pathetique sind weder bis ins Detail durchrecherchiert noch loten sie musikalische Tiefen aus. Sie haben eine stark autobiographische Note.
Neben den Romanen und autobiographischen Texten schrieb Klaus Mann Bühnenstücke, Kurzprosa, Lyrik, aber auch Beiträge für Zeitungen, Journale, Anthologien, gemeinsam mit seiner Schwester Erika auch Reise- und Kriegsberichte. Er versuchte sich auch als Herausgeber. Obendrein gibt es unveröffentlichte Texte, etwa eine Biographie zu Horst Wessel – ein erstaunliches Projekt von Klaus Mann.
Seine anwachsende Liebe zu Frankreich bildete den Kern seiner Entwicklung zum kosmopolitischen Intellektuellen. Dass Klaus Mann 1933 nicht eine Sekunde zögerte, dem nationalsozialistischen Deutschland den Rücken zu kehren, hatte auch damit zu tun.
Thomas Medicus: Klaus Mann
Der schwerwiegendste Bruch folgte 1933 mit dem Machtantritt Adolf Hitlers. Aus dem freiwilligen Vagabunden wurde ein Exilant. Es war ein dramatischer Unterschied, auch wenn sich äußerlich das Umherziehen kaum änderte und Klaus Mann in Frankreich einen Ort hatte, an dem er sich – soweit möglich – wohlfühlte. Doch die Entwurzelung traf ihn schwer, er konnte nicht nach Deutschland zurück, das Gefühl des Ausgestoßenseins traf ihn wie alle anderen Exilanten.
Zu den Gefährdungen und Wirrungen der 1930er Jahre gehört das Drama, dass mit der stalinistischen Sowjetunion eine zweite, auf einer Vernichtungsideologie basierende Diktatur in Europa ihr blutiges Haupt erhob. Die Todfeindschaft zum Nationalsozialismus war das einzige Pfund, mit dem Stalins Reich wuchern konnte – bis zum Hitler-Stalin-Pakt 1939, der unter den ohnehin zerstrittenen Emigranten die bestehenden Gräben zu offner Feindschaft und Hass vertiefte.
Klaus Mann war kein Kommunist, eher ein idealistischer Schwärmer. Als Homosexueller gehörte er zu einer von den Linken wie den Rechten angefeindeten Gruppe; Bertholt Brecht hat sich in dieser Hinsicht mit bemerkenswert schäbigen Äußerungen hervorgetan.
Eine Reise in die Sowjetunion brachte Ernüchterung, die Klaus Mann im Tagebuch klar äußerte; öffentlich blieb er indifferent, obwohl Andre Gide, sein großer Leuchtstern unter den Denkern, mit bemerkenswerter Klarheit die Abgründe von Stalins Reich beschrieb. Familie ging vor Politik. Wegen Heinrich Manns (zutiefst naiver, von Stalins Schergen ausgenutzter) kritikloser Haltung gegenüber der stalinistischen Sowjetunion unterließ Klaus Mann ein klares Statement.
Was erste Jahrzehnte später zu den Grundelementen der Kritik am real existierenden Sozialismus gehörte, formulierte Gide bereits 1936/37 mit großer Klarheit.
Thomas Medicus: Klaus Mann
Einige Jahre später ergab sich für Klaus Mann daraus eine erhebliche Gefährdung. Als die USA nach langer Neutralität durch die Kriegserklärung Deutschlands und Italiens endlich gegen Hitlerdeutschland militärisch vorgingen, wollte er seinen Beitrag leisten. Aus körperlichen und vor allem politischen Gründen wurde er zweimal ausgemustert, vom FBI mehrfach durchleuchtet, verhört und nachtragenden Antikommunisten denunziert.
Klaus Mann befand sich in einer dramatischen Krise, hinter ihm lag ein demütigendes Scheitern mit seiner Zeitschrift Decision, hinzu kamen persönliche Rückschläge, Erkrankunge, die übermächtige Drogensucht und die immer stärker werdenden Todessehnsucht. Seine Schwester Erika ging zunehmend eigene Wege, die gefühlte Isolation wurde stärker, der Hemmschuh zum Suizid fiel weg. Die Teilnahme am Kampf gegen Deutschland sollte für einige Zeit zum Rettungsanker werden.
Klaus Mann erhielt in Uniform Aufschub. Er wurde amerikanischer Staatsbürger und Teil der US-Streitkräfte. Seine Kriegszeit verbrachte er in Nordafrika und Italien, direkt nach der Kapitulation der Wehrmacht fuhr er nach München, in die zertrümmerte Heimat, zu dem ebenfalls halb zerstörten Wohnhaus der Eltern. Es gebe keine Rückkehr, konstatierte Klaus Mann – man kann sich ausmalen, was diese Erkenntnis beim Strauchelnden auslöste.
Die Biographie ist das erste Buch aus meinem Lesevorhaben 12für2025
Thomas Medicus: Klaus Mann
Ein Leben
Rowohlt Berlin 2024
Gebunden 544 Seiten
ISBN: 978-3-7371-0154-7