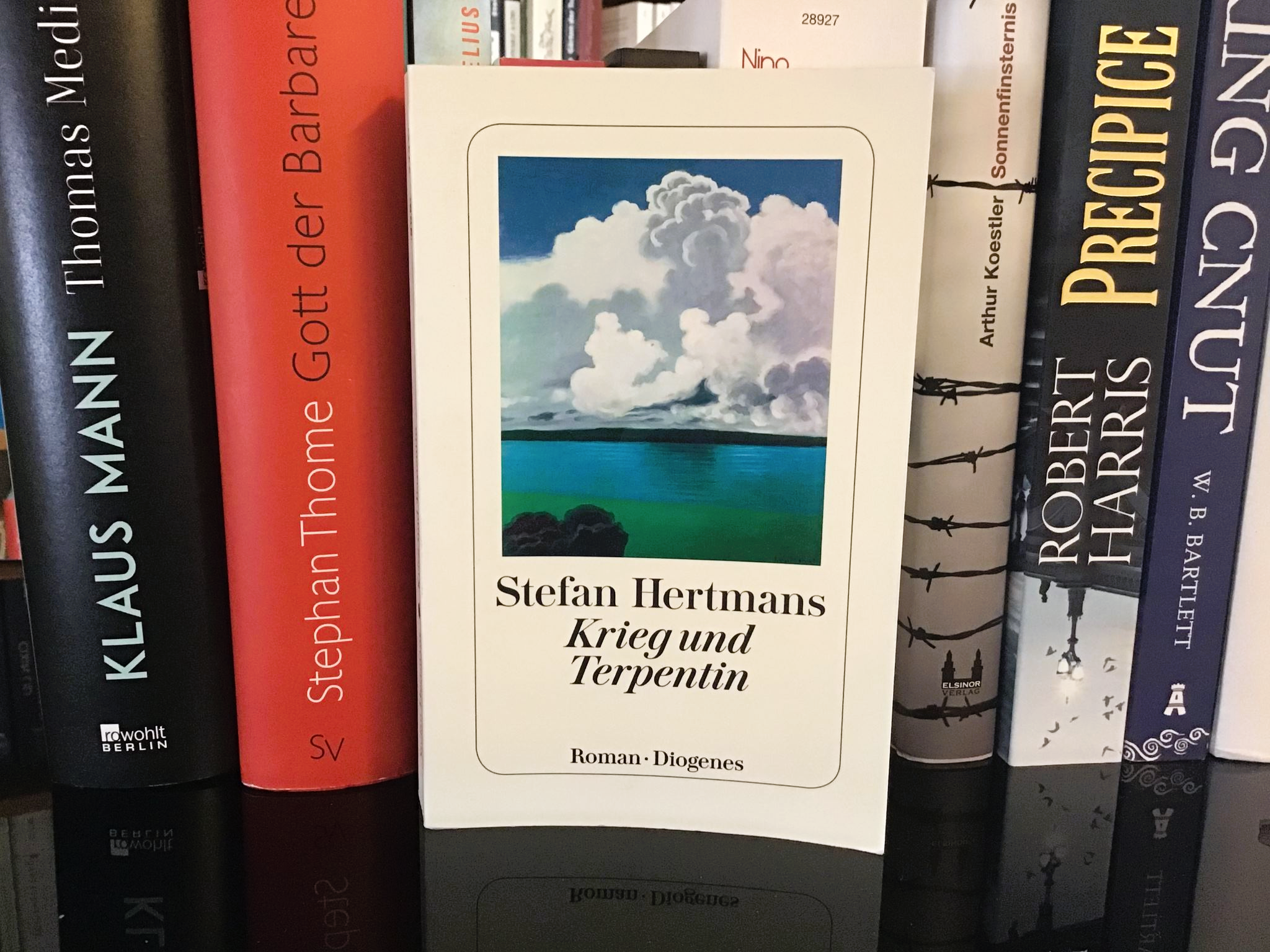Die Zeit des Nationalsozialismus und der einhergehende Zivilisationsbruch einschließlich der historisch völlig einmaligen industriellen Vernichtung von Millionen Menschen steht zwischen der Gegenwart und der deutschen Geschichte vor 1933 wie eine dicke, schwarze Rauchwand. Dahinter bleiben viele wichtige Aspekte und Entwicklungen, positiv wie negativ, oftmals verborgen. Kolonialismus und Sklaverei gehören dazu.
Das Buch Die Sklaverei und die Deutschen, herausgegeben von Jasmin Lörchner und Frank Patalong, bietet einen Zugang zu einer ganzen Reihe von Facetten der Sklaverei und der direkten und indirekten Beteiligung Deutscher an dem finsteren Kapitel. Die Sammlung von knappen, journalistischen Beiträgen hat selbstverständlich ihre Grenzen, wer eine historiographische Monographie erwartet, kann nur enttäuscht werden.
Umgekehrt eröffnet die Herangehensweise einige Vorteile. Ein breites Publikum kann durch das Buch angesprochen und erreicht werden, was angesichts der Bedeutung des Themas für die Gegenwart nur wünschenswert ist. Immer wieder gibt es Debatten um Straßennamen oder Denkmäler, die bisweilen auf Unverständnis treffen und von interessierten Kreisen für schamlose Agitation ausgenutzt werden.
Zeuske: Sklaverei ist die gewaltsame Kontrolle und die Kapitalisierung von Körpern. Da spielen Aspekte wie Geschlecht und Status, extrem viel Arbeit, Ausbeutung, Unterdrückung und körperliche Dienstleistungen mit rein.
Jasmin Lörchner / Frank Patalong (Hrsg.): Die Sklaverei und die Deutschen
Mallinckrodt: Ich fasse Sklaverei enger. […] [Ich] stütze mich auf eine rechtliche Definition, angelehnt an das römische Recht: Ein versklavter Mensch gilt nicht als Person. Er oder sie wurde als bewegliche Habe angesehen, konnte verkauft, vererbt oder verschenkt werden, war selbst nicht rechtsfähig, konnte also nicht als Zeuge aussagen oder klagen.
Nach der Lektüre wird deutlich, wie sehr das Geschäft mit dem Menschenhandel auch in Deutschland gewirkt hat. Völlig in Vergessenheit geraten ist hierzulande, dass ein deutscher Staat einen Anlauf unternommen hat, Macht und Größe durch das Geschäft mit versklavten Afrikanern zu mehren: Brandenburg-Preußen gründete zu diesem Zweck eine kleine Kolonie (Groß-Friedrichsburg) an der so genannten Goldküste und pachtete in Karibik eine Insel, um dort die in Afrika erworbenen Sklaven zu verkaufen. Das blieb Episode, Piraten, andere Kolonialmächte und hauseigenes Desinteresse beendeten das Unternehmen rasch.
Dennoch haben hunderttausende Deutsche beim lukrativen Menschenhandel mitgewirkt. Da waren Kaufleute wie Friedrich Romberg, der als Reeder auf Sklavenschiffe setzte und große Reichtümer anhäufte, ehe ihn Napoleons Kriege ruinierten. Da waren die deutschen Fürsten und Bürger, die ihr Haus mit einem »Hofmohren« schmückten oder einen Afrikaner als Diener »hielten«, die offiziell keine Sklaven waren, aber von Freiheit weit entfernt.
Überraschend ist, wie viele Deutsche etwa in Diensten der Vereinigten Ostindischen Compagnie (VOC) der Niederlande tätig waren und sich auf diesem Weg direkt an Kolonisation und dem Menschenhandel beteiligten. Das waren nicht ein paar hundert oder tausend, sondern hunderttausende Menschen aus deutschen Landen. Städte wie Hamburg und Bremen haben auch direkt von dem Geschäft mit dem Menschenhandel profitiert.
»Deutsche stellten Kapital, Schiffe, Plantagenausrüstung und Kleidung bereit, produzierten Waren für den Tauschhandel und verarbeiteten durch Sklavenarbeit gewonnene Güter wie zum Beispiel Zucker weiter.«
Jasmin Lörchner / Frank Patalong (Hrsg.): Die Sklaverei und die Deutschen
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es kein einiges Deutschland und eigene Kolonien kamen deutlich später, was es erleichterte, die Position zu vertreten, man habe mit dem Sklavenhandel nichts zu tun gehabt. Nach der Lektüre von Die Sklaverei und die Deutschen ist diese bequeme Haltung im Grunde passé. Damit wird die Tür aufgestoßen für ein angemessenes Verständnis aktueller Themen, etwa die Frage von Entschädigungen und Reparationen.
Wirklich gut ist die Vielfalt der Themen, die in dem Buch angerissen werden: sexueller Missbrauch und Ausbeutung weiblicher Sklaven, die Aufstände auf Hispaniola (hier sei auf den älteren Roman von Alejo Carpentier, Explosion in der Kathedrale verwiesen, der sehr schön die Grenzen von Aufklärung und Befreiung zeigt). Aber auch der Vergleich zu der Leibeigenschaft wird ebenso geführt, wie zu der Unfreiheit in den deutschen Kolonien. Nicht zuletzt wird die Versklavung mit Vernichtungsabsicht durch die Nationalsozialisten angerissen.
Besonders beeindruckt haben mich zwei Dinge. Natürlich gab es auch Widerstand, in Form autonomer Territorien entlaufener Sklaven etwa, aber auch durch den Suizid: Versklavte versuchten, über Bord zu springen oder sich zu Tode zu hungern. Nichts verdeutlicht die Verzweiflung, aber auch die Klarsicht der Versklavten über ihr Schicksal deutlicher. Bemerkenswert ist auch, dass Forscher für den Menschenhandel in Afrika, etwa ins Osmanische Reich, wesentlich mehr Betroffene errechnet haben als für den Atlantik-Handel.
Das Thema wird nicht aus der Gegenwart verschwinden, wie nicht zuletzt das Kapitel Mitten unter uns zeigt. Da Zeit das kostbarste Gut ist und viele Leser zwischen einer Unzahl an Publikationen geradezu zerrieben werden, sind Kompendien wie Die Sklaverei und die Deutschen geradezu prädestiniert dazu, einen schnellen, vielfältigen und zur vertiefenden Lektüre und Beschäftigung mit dem Thema anregenden Zugang.
Rezensionsexemplar
Jasmin Lörchner / Frank Patalong (Hrsg.): Die Sklaverei und die Deutschen
Eine Geschichte von Ausbeutung, Profit und Verdrängung
Deutsche Verlags-Anstalt 2024
Hardcover 240 Seiten
ISBN: 978-3-421-07024-1