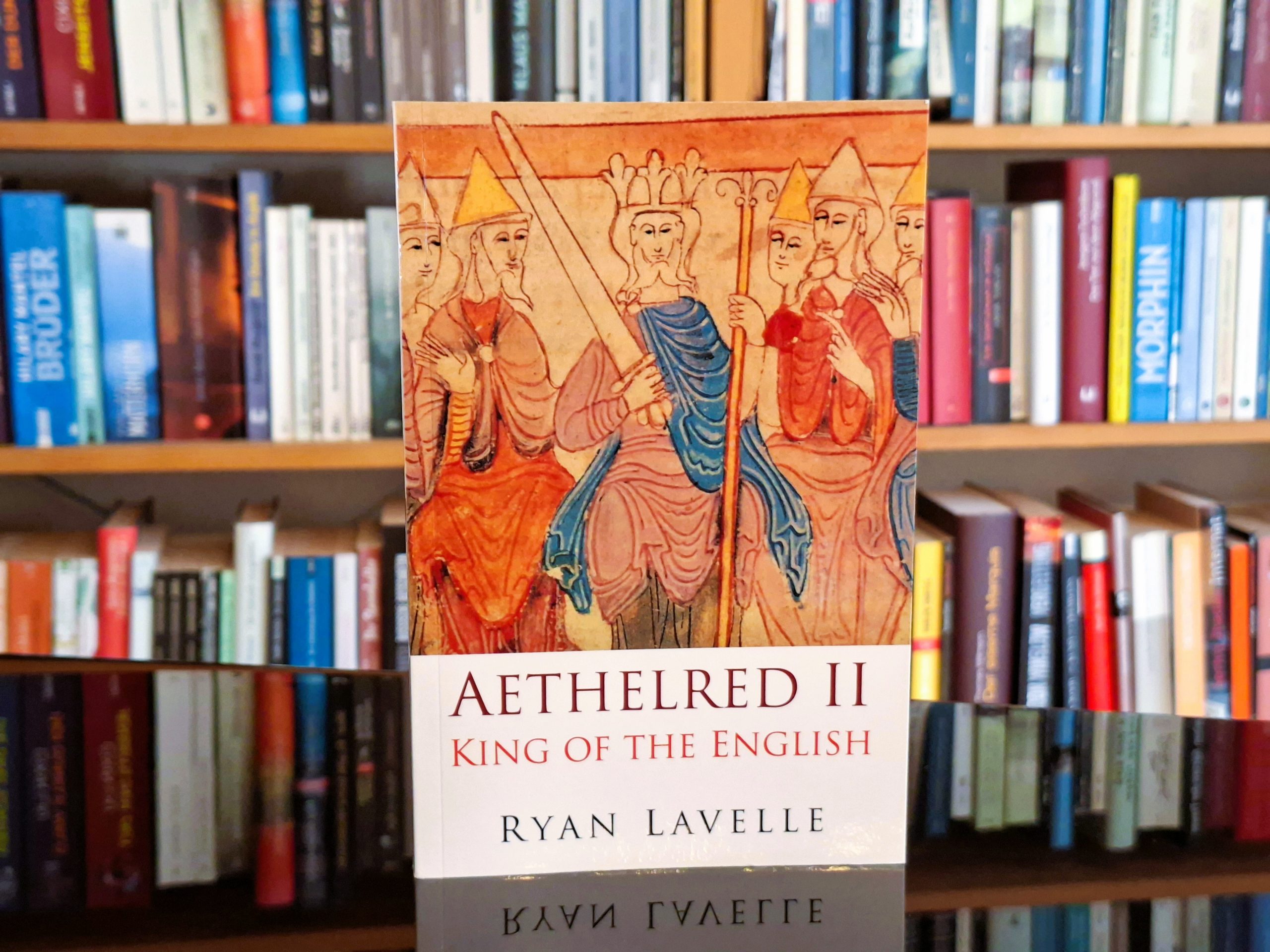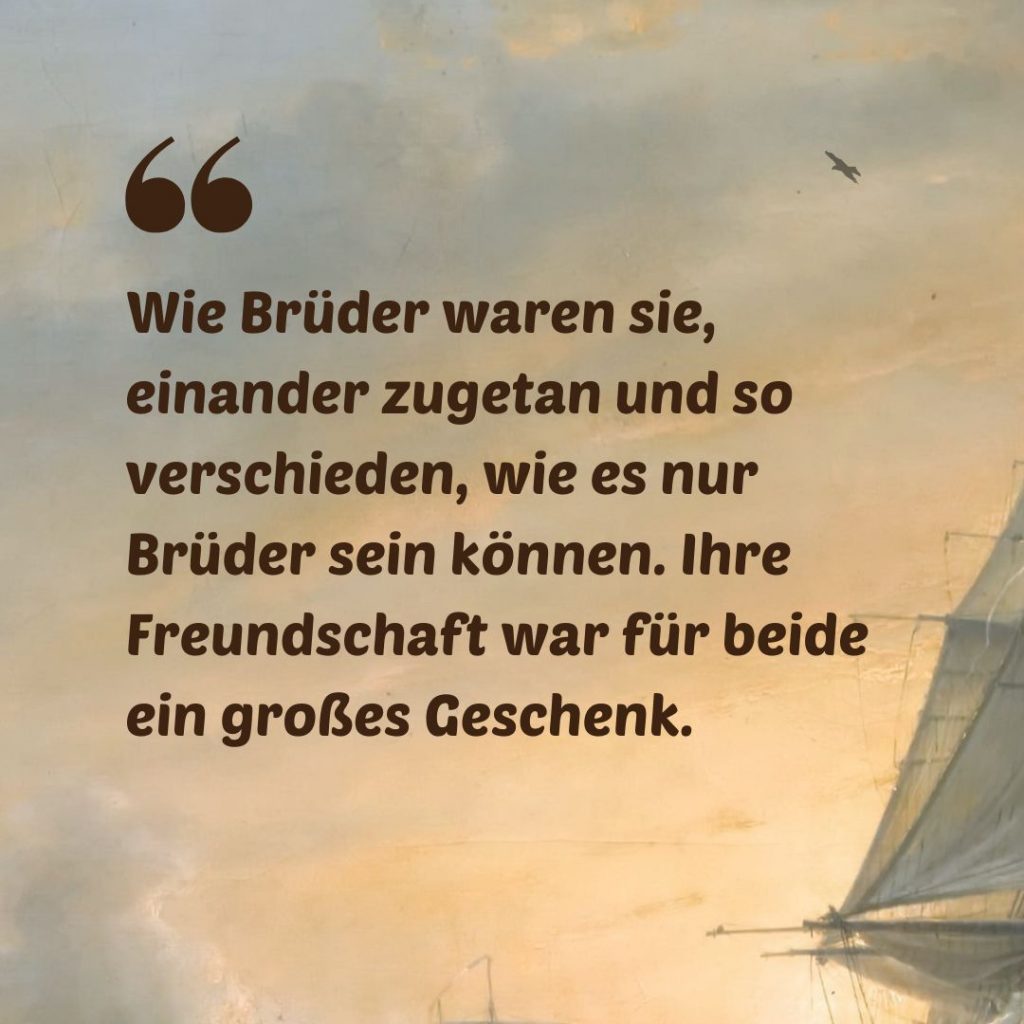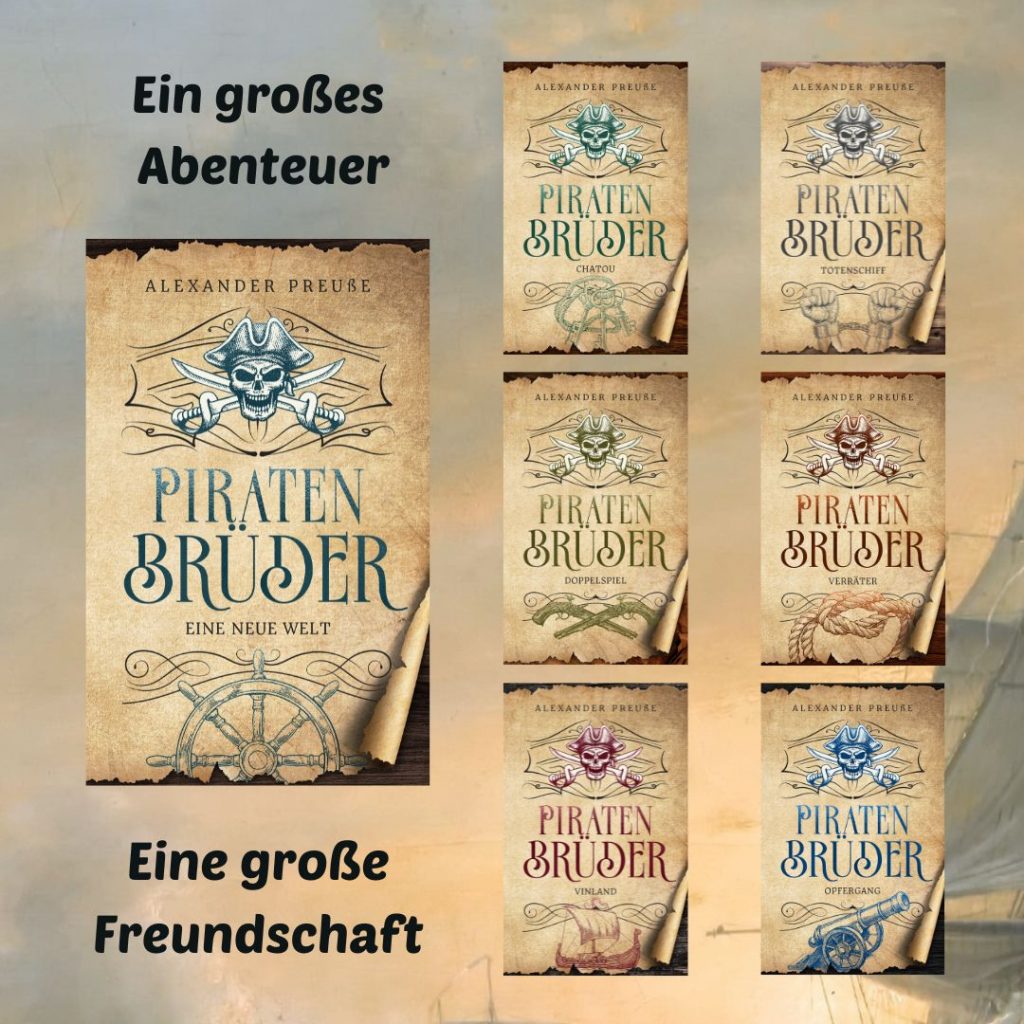Zu den großen Stärken des Romans Blue Skies von T.C. Boyle gehört sein kommentarloser Stil, mit dem der Autor die Figuren in einer Welt agieren lässt, die von der Erderhitzung heimgesucht wird. Nur wenige Personen handeln an wenigen Orten, beim Lesen habe ich mir die Frage gestellt, ob die Handlung nicht recht einfach als Theaterstück umzusetzen wäre.
Wer identifikatorisch liest, gerät bei Blue Skies an eine fast undurchlässige Grenze, denn alle Personen sind makelbehaftet. Boyle lotet einen Teil der menschlichen Abgründe aus, nicht zuletzt den verheerenden Missbrauch von Alkohol. Das hat mir außerordentlich gut gefallen, es schafft eine begrüßenswerte Distanz zu den Figuren. In Blue Skies gibt es keine klassische Retter-Figur wie in Hollywood-Katastrophenfilmen.
Als europäischer Leser muss man mit direkten Übertragungen vorsichtig sein, zumal ich den Verdacht hege, amerikanische Literatur sei gezielt auf die Lesebedürfnisse amerikanische Leser getrimmt. Gesellschaftliche Konventionen, gegenseitiger Umgang und der Life-Style der US-Gesellschaft stehen im Fokus, die Klima-Katastrophe ist eher eine aktive Kulisse. Diese wirkt auf das Leben der Romanpersonen ein, von einer konsequenten Dystopie im Stile von Cormac McCarthys Die Straße ist Blue Skies weit entfernt.
Kurios, dass alle einfach weitermachen, sich in kleinstmöglichen Teilen anpassen, ohne eine grundsätzliche Änderung der Lebensweise vorzunehmen. Man fährt mit seinem Auto durch kniehohes Meerwasser, überflutete Straßen gehören zur Normalität, ein Boot wird zum alltäglichen Mobilitätsvehikel. Und doch werden Schlangen verkauft, wird Barcadi promotet, gestritten, betrogen, gelogen als gäbe es noch abertausend Morgen. Der Topos, dass sich alle zusammenreißen und – noch märchenhafter – ein gesamtgesellschaftlicher Umschwung erfolgt, wird hier konsequent negiert. Die Menschen stecken in ihren Mustern fest.
Manche Dinge in diesem Roman wirken unausgegoren: Inmitten harscher Trockenheit und Wasserknappheit ist der Pool noch gefüllt, als gäbe es keine Verdunstung. Die Spülmaschine läuft ununterbrochen, merkwürdig bei knappem Wasser und langen Stromausfällen. Ungereimtheiten, die übertroffen werden vom Romanende, mit dem ich hadere. Ein Natur-Elysium (als Hoffnungsschimmer?), wie es kitschiger kaum sein könnte. Ausgerechnet ein Milliardär unternimmt etwas gegen die Erderhitzung, was in der garstigen Gegenwart unserer Tage wenigstens für Naserümpfen sorgt.
Trotz einiger Kritikpunkte überwiegt bei mir der positive Eindruck. Ich habe das Buch teilweise gehört und auf Deutsch sowie im Original gelesen. Der Hörbuch-Vortrag war mir zu schnodderig, die Ironie und Komik, die Boyle in sein Erzählen eingeflochten hat, wurden so übergebügelt. Ob ich die im Original ausreichend wahrgenommen hätte, sei einmal dahingestellt.
T.C. Boyle: Blue Skies
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren
Hanser Verlag 2023
Gebunden 400 Seiten
ISBN 978-3-446-27689-5