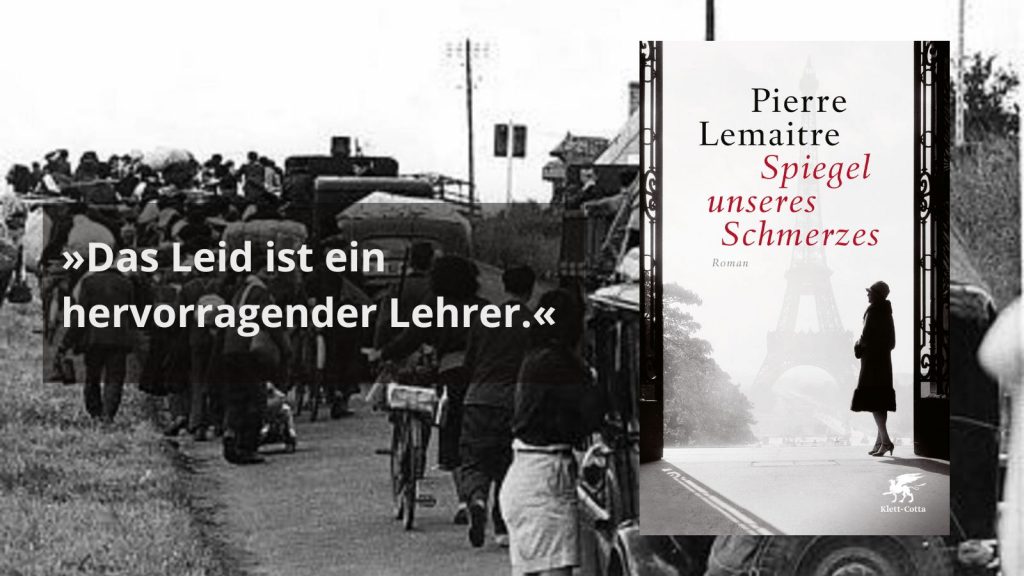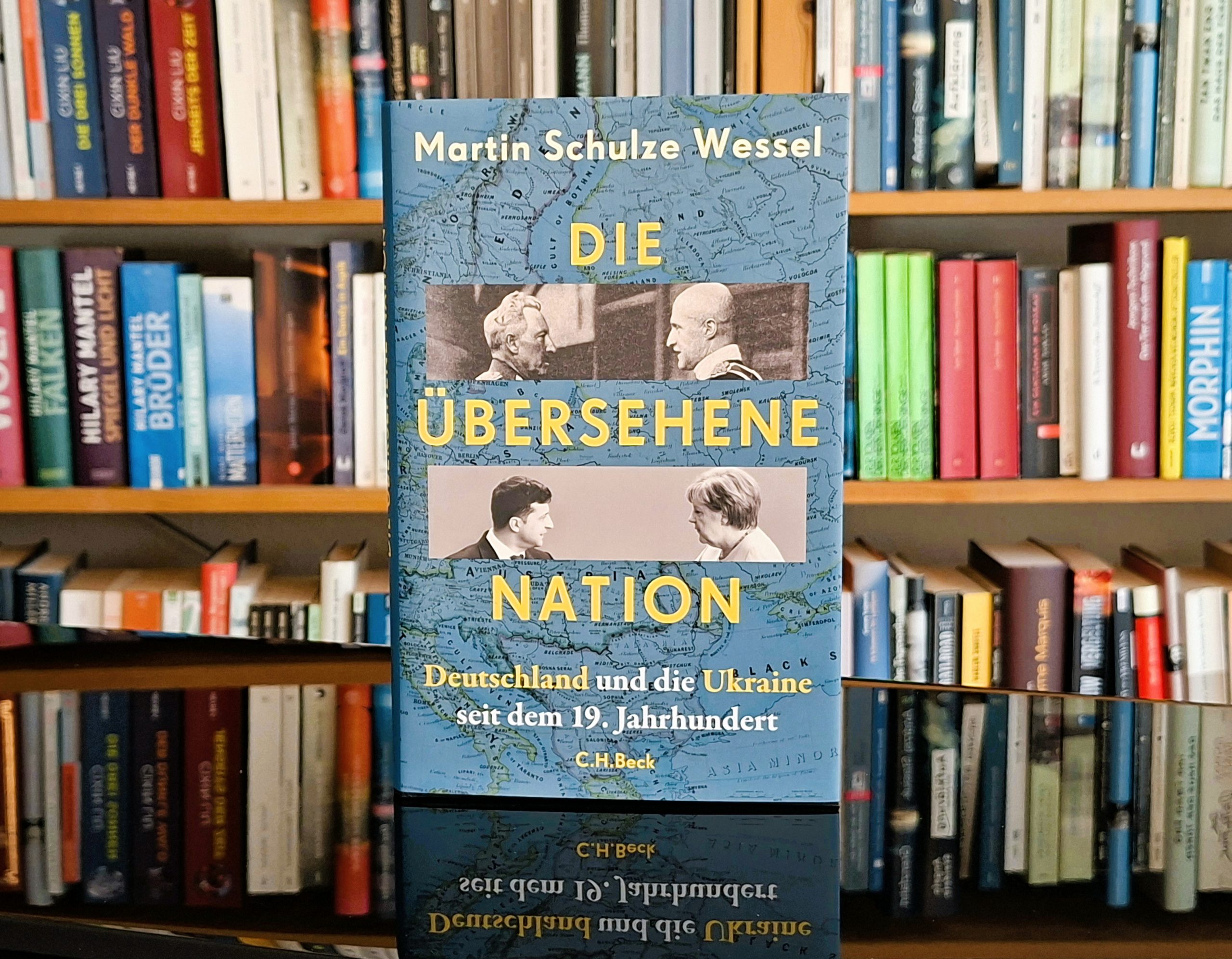Ende Mai 2022 ist der Schriftsteller Friedrich Christian Delius verstorben. Im Netz gibt es so viele Nachrufe, dass ich keinen hinzufügen möchte, stattdessen will ich meine Begegnungen mit seiner Literatur schildern. Der Grund ist: Delius hat einige sehr interessante, unterhaltsame und vor allem inhaltlich gewinnbringende Romane und Erzählungen verfasst, die »Birnen von Ribbeck« einmal ausgenommen.
Ich war selbst ein wenig überrascht, wie viele Bücher ich von ihm gelesen habe. In meinem Regal nehmen sie nur einen vergleichsweise geringen Raum ein, denn ich besitze nur Taschenbücher, außerdem fallen die Werke zum Teil recht schmal aus. Das ist aber kein Nachteil, denn Delius hat etwas zu sagen, wofür er eben nicht episch ausholen muss.
Das gilt für mein Lieblingsbuch von ihm: »Die linke Hand des Papstes«. Es ist ein perfekter Reisebegleiter für einen Trip nach Rom. Dort habe ich es mit großen Vergnügen ein weiteres Mal gelesen, abends, wenn es frisch geworden war und ich davor in meiner kleinen Unterkunft Schutz gefunden hatte. Tagsüber habe ich die üblichen Stätten der Stadt besucht und bin immer wieder auf einen caffé al banco irgendwo eingekehrt. Merke: Ein mürrischer Barista zaubert bisweilen tollen caffé.

Das Buch über die linke Hand des Papstes reicht weit über Rom hinaus. Delius, der in dieser Stadt 1943 das Licht der Welt erblickte, hat mit Italien einige Rechnungen zu begleichen, die sich als Gegenpart der unerträglichen Schwärmerei gegenüber diesem Land lesen. Gesellschaftlich, politisch und religiös herrschen unappetitliche Zustände, die der Autor wunderbar boshaft und mit sehr spitzer Feder zu Papier bringt.
Besonders beeindruckt hat mich »Die Frau, für die ich den Computer erfand«. Was für ein Titel! Und was für eine Form! Delius nutzt die Szenerie eines Interviews bzw. Gesprächs, bei der nur der Befragte zu Wort kommt. Ja, so kann man einen ganzen Roman erzählen. Und was für einen. Konrad Zuse hat während des Zweiten Weltkrieges einen Computer gebaut, der tatsächlich funktionierte – 1945, in Göttingen, meiner Wahlheimat. Hier können Sie lange nach einem Hinweis darauf suchen, was sehr viel mehr über diese Stadt, die angeblich »Wissen schafft«, sagt als alle hübschen Fachwerkbauten.

Richtig gern gelesen habe ich auch »Die Flatterzunge«. Ein Musiker tourt mit seinem Orchester in Israel und unterzeichnet einen Getränkebeleg mit »Adolf Hitler«. Was nach dieser Entgleisung folgt, kann man sich denken, auch wenn die dem fiktionalen Text zugrundeliegende Handlung 1997, also lange vor den so genannten digitalen Scheiterhaufen namens Soziale Medien geschah. Was treibt jemanden zu so einer Tat? Delius gibt eine Art von Antwort.
Das erste Buch des Autors, was mir in die Hände fiel, war »Bildnis der Mutter als junge Frau«. Ein langer Innerer Monolog einer Einundzwanzigjährigen, die im Januar 1943 durch Rom geht, hochschwanger (Delius kam im Februar 1943 in Rom zur Welt), während ihr Mann in Afrika soldatiert. Es ist jene Zeit, als in Stalingrad eine ganze Armee verreckt und das große Sterben auch auf deutscher Seite beginnt; der befremdete Blick auf die scheinfriedliche Umwelt Roms aus einer Frau »in anderen Umständen« heraus ist berührend.

Ein ganz besonderer Reise-Roman ist »Spaziergang von Rostock nach Syrakus«, bei der Delius seinen Protagonisten auf den Spuren von Johann Gottfried Seume (»Spaziergang nach Syrakus«) nachvollziehen lässt. Aber: Die Hauptfigur lebt in der DDR, die sie illegal verlassen muss, um den Lebenstraum einer Reise nach Italien zu verwirklichen.
Besonders schön ist auch »Der Tag, an dem ich Weltmeister wurde«. Es verknüpft einen der Gründungsmythen der Bundesrepublik Deutschland, den WM-Sieg 1954, mit dem Befreiungsschlag eines Kindes, das sich aus dem erstickenden Überbau des heimischen Pastorvaters herauskämpft. Ein Fußballbuch? Nein.

Der Roman »Mein Jahr als Mörder« dreht sich um die mörderische Wut, die ein ungerechtes Urteil entflammen kann. Der Nazi-Richter Hans-Joachim Rehse, der während des so genannten Dritten Reichs unter anderem Widerstandskämpfer zum Tode verurteilt hatte, wird in der Bundesrepublik freigesprochen. Die Empörung lodert hell, ein Student entschließt sich zur Tat. Delius nimmt hier die Nachkriegsjustiz aufs Korn und berührt die uralte Frage nach »Gut« und »Böse«.