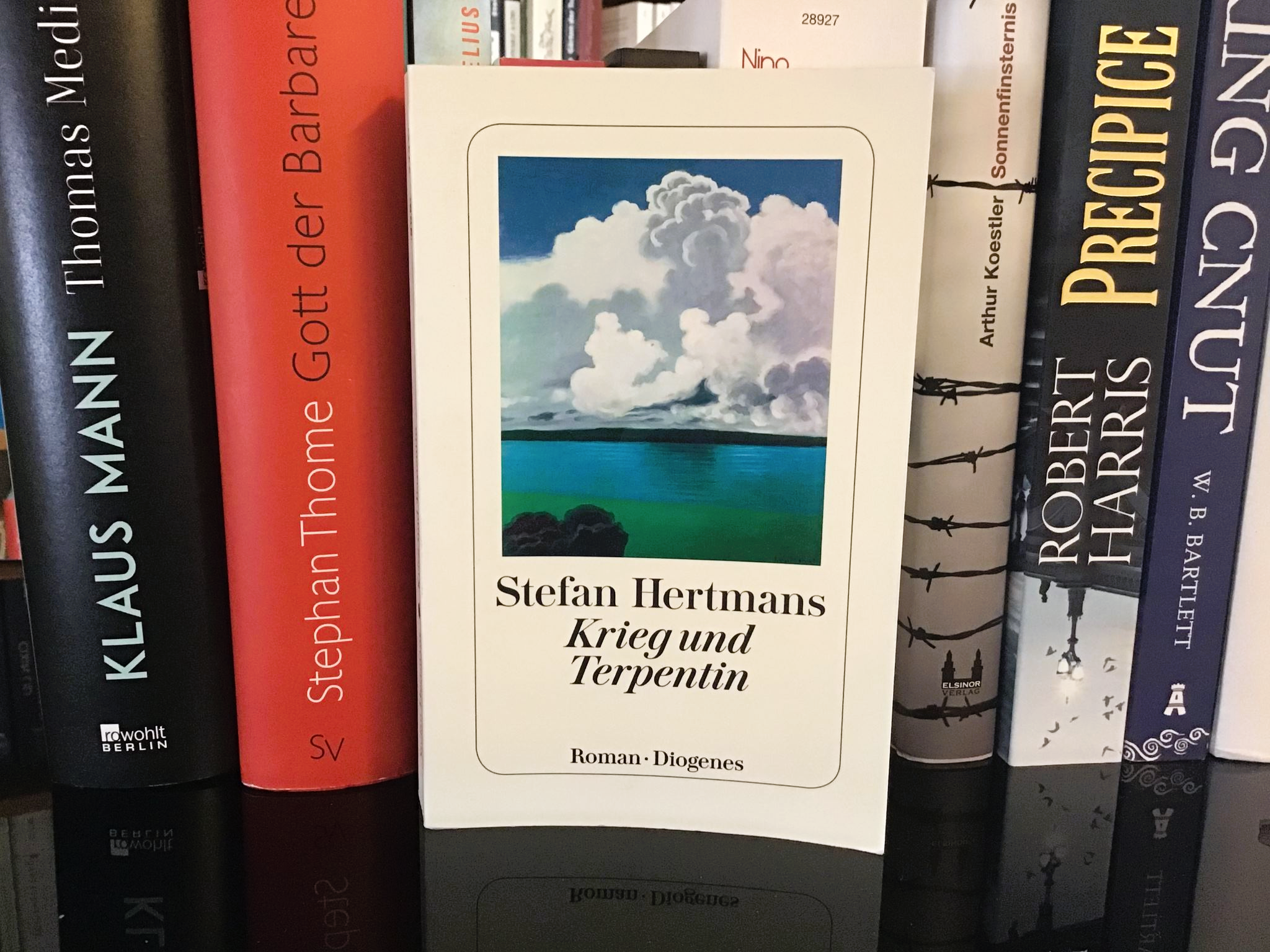Das ganze Elend westlicher Gesinnungsethik und blinder Russophilie wird am Beitrag von Jens Herlth deutlich, der sich gegen einen pointierten Essay der ukrainischen Schriftstellerin Oksana Sabuschko zu russischer Literatur und Kriegsverbrechen richtet. Slawist Herlth unternimmt einen hilflosen Versuch, zu verteidigen, was nicht zu verteidigen ist.
In dem fabelhaften Sammelband »Alles ist teurer als ukrainisches Leben« gibt es – zum Glück – mehrere weitere Beiträge, die Herlth entschieden widersprechen und widerlegen. Das alles muss hier nicht wiederholt werden, stattdessen seien die Aspekte genannt, die am Beispiel eines Einzelnen zeigen, worauf der gesamte Band abzielt.
Bemerkenswert ist vor allem die Argumentationslinie Herlths, die ungewollt jene blinden Flecken offenbart, mit denen viele westliche Blicke gen Osten behaftet sind. Einmal nur gebraucht Herlth in seiner Replik das Wort »menschenverachtend«. Butscha? Folterlager? Kindesentführungen? Terrorangriffe? Vergewaltigungen? Die genozidale Propaganda des Putin-Regimes?
Keineswegs. Herlth empört sich darüber, dass für russländische Soldaten der Begriff »Ork« verwendet wird und – in den sozialen Medien, also keineswegs offiziell (!) – der Wunsch geäußert wird, die Invasoren mögen Dünger für ukrainische Felder werden. Wäre Slawist Herlth auf der Höhe der Zeit, wüsste er, dass selbst russische Regime- und Kriegskritiker ihr Land als »Mordor« bezeichnen.
Das ist in einer erschütternden Weise erbärmlich und bezeichnend: Herlth argumentiert »als ob«: Als ob Russland keinen Angriffskrieg führen würde; als ob es keinen Unterschied zwischen dem Angreifer und dem Angegriffenen gäbe; als ob die Herabwürdigung von Angriffskriegern gleichwertig mit deren verabscheuungswürdigen Verbrechen an Zivilisten und Kriegsgefangenen wäre.
Der moralische Kompass scheint bei Herlth ein wenig durcheinandergeraten, und wer die Welt so verzerrt betrachtet, gerät recht schnell selbst in Ork-Verdacht. Dabei gäbe es an der scharfen Attacke, die Sabuschko gegen die russische Literatur reitet, einiges zu besprechen, wie die Beiträge von Karlolina Kolpak & Aleksandra Konarzewska sowie Mathew Omolesky zeigen: Man müsste nur offen zuhören, statt schnappatmig zurückzukeifen.
Ukrainische Leben sind weniger wertvoll. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine ethische Wahl.
(Kateryna Mishchenko)
Eine der wesentlichen, in diesem Band immer wiederkehrenden Fragen ist: Soll man trotz des russländischen Angriffskrieges noch russische Literatur lesen oder wegen ihrer imperialen DNA boykottieren? Recht einheitlich ist die Ablehnung, gemeinsam mit russländischen Künstlern aufzutreten, auch wenn sich diese gegen Putin aussprechen.
Das sorgt in kultur- und ausgleichsbeflissenen westlichen Kreisen für Naserümpfen, ein gutes Zeichen dafür, dass diese Kreise noch immer nicht begriffen haben. Auf die Frage, ob, was und wie man russische Literatur lesen sollte, gibt es vielfältige Antworten; tatsächlich spricht einiges dafür, vor allem ukrainische Literatur zu lesen, weil sie gut ist und es ein Akt kultureller Dekolonisation sein kann.
Damit ist das Feld bereitet: »Alles ist teurer als ukrainisches Leben« bietet dank der Fülle an Beiträgen eine Menge an Themen und Sichtweisen, über die man nachdenken kann, ja sollte, muss. Da wäre jener von Timothy Snyder, der sich mit der fehlgeleiteten, verheuchelten deutschen Erinnerungskultur auseinandersetzt, welche die Ukraine Hand in Hand mit (Sowjet-)Russland ausblendet.
Man reiste nach Moskau, um dort Absolution (und Erdgas) zu bekommen.
(Timothy Snyder)
Noch wichtiger sind aus meiner Sicht jene wütenden, schonungslosen Auslassungen von Szczepan Twardoch, der gleich zweimal zu Wort kommt. Seine Zeilen sind nicht angenehm zu lesen, aber ungeheuer wichtig, denn für die im Westen Geborenen, die in der komfortablen Bequemlichkeit ihrer Wachstums-Demokratie aufgewachsen sind, ist es unangebracht, Osteuropa zu belehren.
Es geschieht dennoch, insbesondere mit Blick auf Russland. Twardoch beschreibt das sehr passend als paternalistisch-herablassend, was bereits vor dem 24. Februar 2022 zu dramatischen Verwerfungen in osteuropäischen Staaten geführt hat. Der Schock über den russländischen Angriffs- und Vernichtungskrieg war dort nicht so groß, weil man sich keinen grotesken Illusionen und Schönrednereien hingegeben hat.
Twardoch ist gnadenlos. Mit Vevre, aber keineswegs blindwütig zieht er in die Schlacht und unternimmt einen Streifzug durch die russländische Gewaltgeschichte. Dabei macht er auch nicht von Säulenheiligen á la Alexander Solschenizyn halt, der im Westen dank seines »Archipel Gulag« einen besonderen Ruf genießt und mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.
Liebe westeuropäische Intellektuelle: Ihr habe keine Ahnung von Russland.
(Szczepan Twardoch)
Für Twardoch verbindet sich die Gräuel von Butscha mit dem Gesicht Solschenizyns und zwar mit dem des jungen Artilleriehauptmanns, der beim Einmarsch in Ostpreußen dabei gewesen war und – als kommandierender Offizier – zwar nicht an den Vergewaltigungen von Zivilistinnen teilnahm, aber diese eben auch nicht unterbunden hat.
Vor diesen »Befreiern« ist die halbwüchsige Großmutter Twardochs geflohen, der Großvater musste im Januar als desertierter Volkssturmler mit ansehen, wie der sowjetische NKWD wahllos Erschießungen vornahm. Davon zieht Twardoch eine Linie zur Gegenwart und stellt die Frage, was nach Putins Abgang geschehen werde. Tauwetter statt Morgethau-Plan, fürchtet er.
Klingt brutal? Wer Witold Jurasz’ Beitrag liest, in dem er schonungslos aufzeigt, wie die Hörigkeit gerade deutscher Eliten gegenüber Russlandmythen Europa zerstört, wird eines Besseren belehrt. Das Kind namens europäische Integration liegt tief im Brunnen und wenn man auf das kommunikative Desaster (!) um die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine schaut, versinkt es Tag für Tag weiter.
[…]eine Politik, deren Tenor von deutschen Politikern bestimmt wird, wie sie jahrelang Nord Stream 2 forcierten und Russlandprognosen trafen, von denen keine einzige eingetreten ist. Die Kompromittierung der deutschen Russlandpolitik ist leider kein Argument für, sondern gegen die vertiefte Integration.
(Witold Jurasz)
Jurasz legt den Finger in die Wunde, wenn er die Doppelzüngigkeit und das fehlende Augenmaß von Menschenrechtlern kritisch beleuchtet. Diese übersehen russländische Verbrechen und gestatten Russland Rechte, die man »den Amerikanern niemals zugestanden hätte«. Völlig zurecht weißt er daraufhin, dass US-Journalisten für ihre Berichte über Menschenrechtsverletzungen nicht sterben, russländische von »Unbekannten« ermordet werden.
Aus »Alles ist teurer als ukrainisches Leben« lassen sich spektakuläre Ideen ziehen. Was soll mit der russischen Sprache in der Ukraine geschehen? Zunächst einmal sollte klar sein, dass die Ukraine zweisprachig ist, Gwendoly Sasse hat das »kontextabhängige Bilingualität« genannt. Russisch wird aus dem Alltag nicht komplett verschwinden. Oleksiy Radynski unterbreitet den Vorschlag, sie in Ostukrainisch umzubenennen, was aus unterschiedlichen Gründen eine Menge Charme hat.
Damit verbindet sich eine sehr weitgehende Idee, nämlich die russische Kultur zu dekonstruieren. Radynski meint damit, dass etwa deren »Pantheon« neu gestaltet gehört; statt ihn »Tolstojewski« zu überlassen, sollte man Schriftsteller wie Nikolaj Leskow aufnehmen, der eine ganz andere Perspektive in und aus Russland gibt.
Die russische Sprache gehört uns, wir geben sie Putin nicht her.
»Alles ist teurer als ukrainisches Leben«
(Oleksiy Radynski)
Das ist ein schönes Beispiel dafür, auf welch’ eingedampften Niveau im Westen oft Diskussionen geführt werden – die Basis der Argumentation ist dünn, trotzdem werden weitreichende Aussagen getroffen. Dafür gibt es den Begriff des »Westplaining«, der von Aliaksei Kazharski beleuchtet wird. Es ist eben nicht ein geographischer Ausschluss von Meinungen, sondern bezüglich der fachlichen Kompetenz.
Auch in diesem Beitrag geht es differenziert zu, denn Kazharski erweitert »Westplaining« durch »Russosplaining« und »Ukrosplaining«. Der erste Begriff zeigt, wie fatal uninformiertes Urteilen sein kann, denn die russische Sicht vor dem Angriffskrieg projizierte Annahmen und Ideologien auf die Ukraine, wodurch der Blitzkrieg scheiterte.
Klar formulierte Kritik ist zugegebenermaßen unangenehm, doch wann ist es das nicht, wenn einem ein Spiegel vorgehalten wird? Dieser hier hat vielfältige Facetten und ist umso wertvoller. Am Ende nämlich, wenn alle Beiträge gelesen und reflektiert sind, bleibt die Erkenntnis, dass Oksana Sabuschko mit ihrer fulminanten Attacke vielleicht in der Wahl der Worte, doch nicht im Kern ihrer Aussage überzogen hat. Eine Neubewertung des imperialen Russland ist dringend nötig. Bis dahin heißt die Devise: Fack ju, Puschkin.
[Rezensionsexemplar]
»Alles ist teurer als ukrainisches Leben«
Aleksandra Konarzewska, Schamma Schahadat, Nina Weller (Hrsg.)
edition fotoTAPETA 2023
Broschur 272 Seiten
ISBN: 978-3-949262-29-6