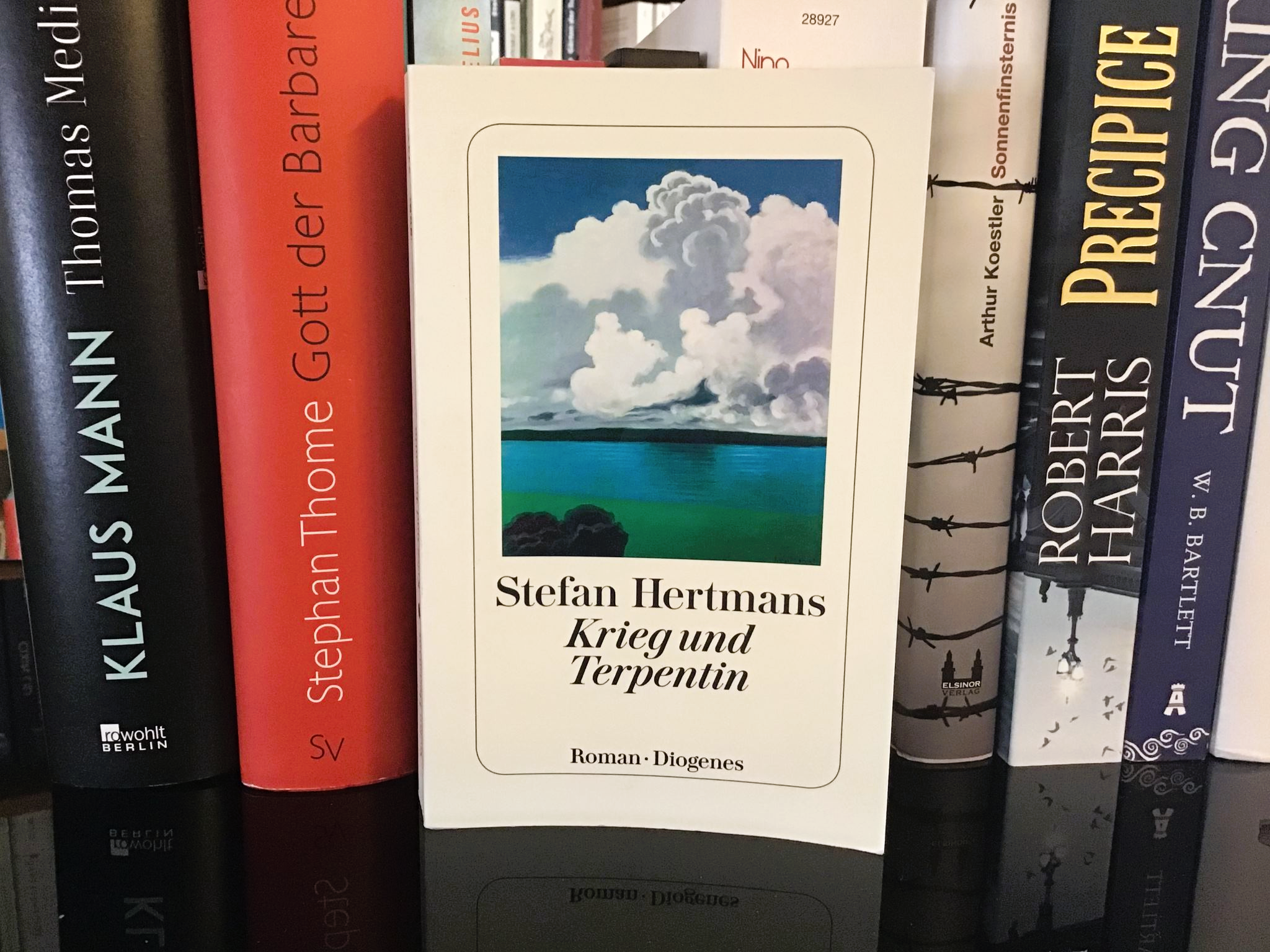Der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway ist mir fremd. Ein einziges, kümmerliches Buch habe ich von ihm gelesen. Ich kann nicht einmal behaupten, »A Farewell to Arms« hätte mir nicht gefallen, im Gegenteil: Soweit ich es nach mehreren Jahrzehnten noch in Erinnerung habe, mochte ich das Buch.
Ich glaube mich sogar an eine spezifische Textstelle zu erinnern, in der Hemingway seiner Hauptfigur Gedanken über die Kampfkraft von Österreichern (Operettenarmee) und Deutschen (gefährlich) andichtet. Ein Erinnerungsfetzen über eine so lange Zeit ist gewöhnlich ein untrügliches Zeichen dafür, dass ein Buch bei mir etwas hinterlassen hat.
Je mehr man beim Schreiben eigene Wege geht, umso einsamer wird man.
Leonardo Padura: Adiós Hemingway
Und trotzdem Funkstille. Auch in anderen Romanen, die ich bislang gelesen habe, tauchte der Name Hemingway sehr selten auf. Das hat sich jüngst geändert. Steffen Kopetzky lässt in „Propaganda“ seinen Protagonisten John Glueck mit dem Großmeister der US-Literatur im Jahr 1944 nahe Paris zusammentreffen.
Das geschieht zu einem Zeitpunkt, da dieser bereits »fett« geworden ist und zu straucheln beginnt, auf der Suche nach dem großen Roman über den Zweiten Weltkrieg, dem amerikanischen »Krieg und Frieden«. Trotz der Zwischentöne ist dieser Hemingway noch lichtumflort, seine Tragik beginnt sich nur abzuzeichnen, ganz im Gegensatz zu »Cheminguey« im Roman »Adiós Hemingway« von Leonardo Padura.
Die lange Auffahrt zu dieser Buchvorstellung sei mir verziehen, aber im Kern geht es Padura um den Schriftsteller, auch wenn er das ganze hinter einem sehr durchsichtigen Wandschirm namens Kriminalfall verbirgt. Der Autor reaktiviert seinen in Frührente gegangenen Ermittler Mario Conde und schickt ihn auf die Suche nach dem Mörder eines Toten auf der Finca Virgía, Hemingways Residenz auf Cuba.
Nun war er ein beschissener Privatdetektiv in einem Land, in dem es weder Detektive noch Privatleben gab, mit anderen Worten: Er war eine schiefe Metapher in einer schiefen Wirklichkeit.
Leonardo Padura: Adiós Hemingway
Padura geht es in seinen Romanen immer um diese wundervoll formulierte »schiefe Wirklichkeit« unter der Zuchtrute des diktatorischen Regimes mit rostroter Farbe. Hemingway hat davon nichts mehr mitbekommen, zu seinen Zeiten auf der Insel waren Castro und Guevara ein fernes, sich näherndes Unwetter revolutionärer Umtriebe. Wenn also auf der zweiten Zeitebene des Buches von dem Titanen der amerikanischen Literatur die Rede ist, dann geht es um die Zeit vor der Revolution.
Wer sich politisch nicht auskennt, möge vielleicht einen kurzen Blick auf den entsprechenden Artikel bei Wikipedia werfen, um zu verstehen, wie mehrschichtig die Ambivalenz ist, mit der ein cubanischer Schriftsteller fast vier Jahrzehnte nach dessen Tod dem amerikanischen »Gast« auf der Insel begegnet. Besonders dieser Umstand macht »Adiós Hemingway« für mich so lesenswert.
…wie sehr Hemingway in seiner naiven Eitelkeit zu einem Instrument in den Händen der stalinistisches Propaganda geworden war.
Leonardo Padura: Adiós Hemingway
Mario Conde ist zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Romans bereits in vier anderen Büchern auf Verbrecherjagd gegangen, ehe er den Job eines Polizisten geschmissen hat, schriftstellert (bis dahin unerfüllte Sehnsucht) und als Antiquar seine Brötchen verdient. Hemingway ist für ihn eine gewaltige Inspiration gewesen, bis er sich anlässlich der immer deutlicher werdenden Schattenseiten von ihm distanzierte; ihn zu verachten, ja fast zu hassen begann.
Ihm bietet sich nun die Gelegenheit, Hemingways langer (und explizit aufgeführter) Liste an Charakterschwächen eine weitere, schwerwiegende hinzuzufügen: Mord. Die Jagd nach den Hintergründen, die zum Tod der Person geführt hat, die auf dem Grundstück der Villa gefunden wurde, wird zum Kampf um das Erbe des Schriftstellers. Aber auch um die Frage, ob man eine Gelegenheit nutzen oder Gerechtigkeit walten lassen will, und um den Platz, den der Testosteron-Schreiber erhalten soll.
Vor allem jedoch beschwerte ihn die Schuld, stets das Leben der Literatur, das Abenteuer der schöpferischen Kunst vorgezogen zu haben.
Leonardo Padura: Adiós Hemingway
Padura lässt Hemingway selbst zu Wort kommen, denn sein Roman hat zwei Zeitebenen. Für mich immer eine willkommene Erzähltstruktur. Die beiden Erzähllinien sind gut miteinander verknüpft, wer sich für den Mordfall interessiert, wird einen Hauch Spannung empfinden. Vor allem aber bietet es für Padura die unschätzbare Möglichkeit, seine Haltung zu Hemingway darzulegen.
Es soll nicht allzu viel vorweggenommen werden, aber sie ist natürlich indifferent. Padura hat sich dafür entschieden, die allerletzte Lebensphase Hemingways zum Leben zu erwecken, als der Lebenswandel massiv auf die Gesundheit und die Fähigkeit, etwas zu Papier zu bringen, durchschlug. Eine tragische Gestalt im Schatten seiner selbst.
Er hatte einen vom Leben besiegten Mann gesehen. Einen Monat später hat er sich erschossen.
Leonardo Padura: Adiós Hemingway
Was mich besonders angesprochen hat, ist der Aspekt des Schreibens. Von (fast) allen klischeehaften, naiven Vorstellungen ist »Adiós Hemingway« weit entfernt, Schreiben ist immer eine Art gewalttätiger Auseinandersetzung, wenn man nicht nur Worte aneinanderreiht, um dem Leser Handlungsspannung zu bieten.
Am Ende dieses kurzen und kurzweiligen Buches ist man als Leser reicher. Hemingway tritt in einer ganz besonderen Gestalt hervor, ein Schriftsteller, der den Nobelpreis nicht persönlich angenommen, aber auch nicht verweigert hat, ein Amerikaner, der in den USA nicht mehr leben konnte und auch nicht zum Cubaner wurde, zwar auf der Insel, aber nicht mit ihren Bewohnern lebte und sich nie in eine Cubanerin verliebte. Aber eben auch jenen, der den einfachen Menschen zuhörte, wenn er mit ihnen Zeit verbrachte.
Leonardo Padura: Adíos Hemingway
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
Unionsverlag 2013
Broschiert 192 Seiten
ISBN: 978-3-293-20614-4