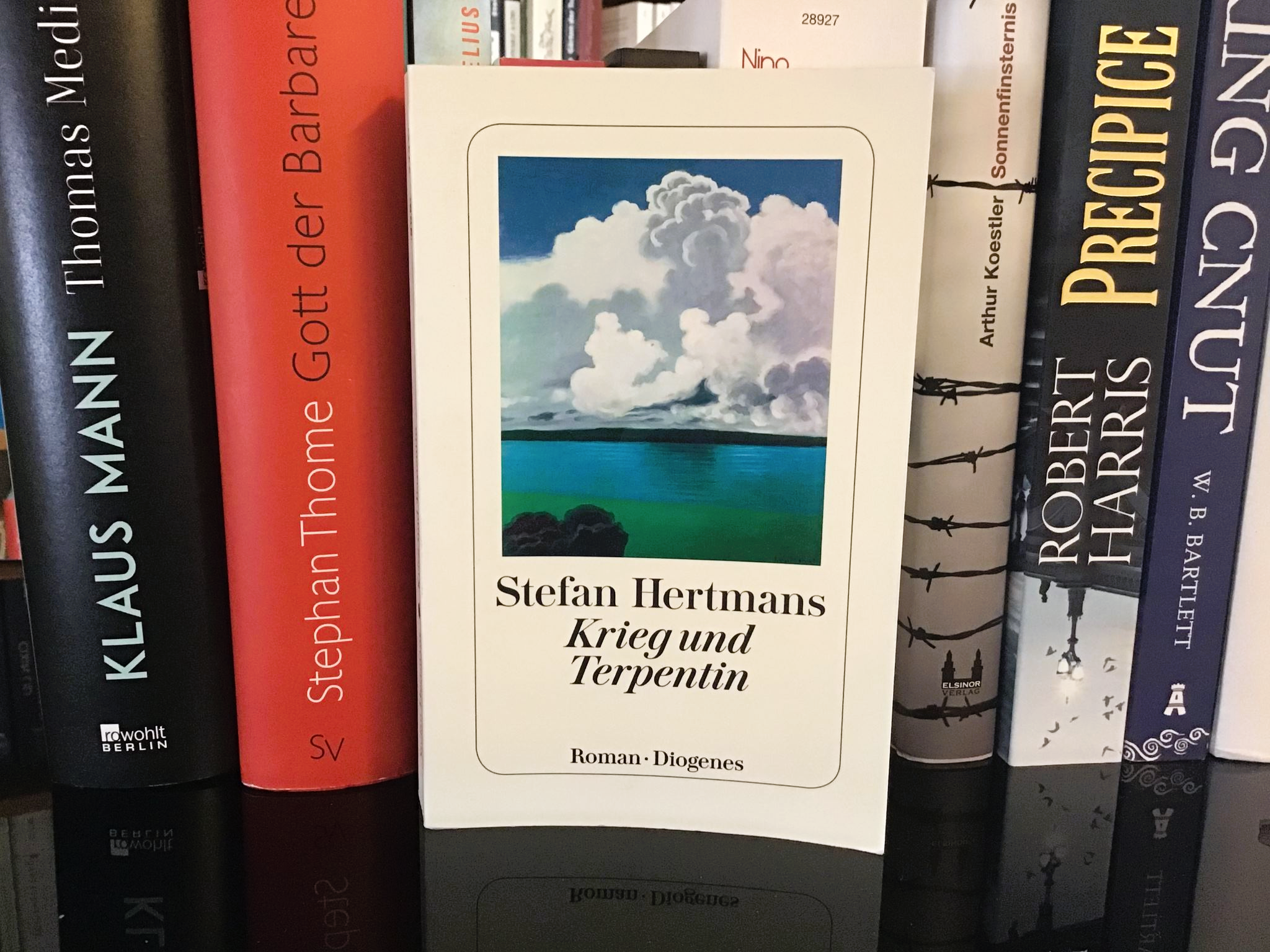Zwischen Frieden und Krieg gibt es eine Art Niemandsland, wenn der eine zwar gegangen, der andere aber noch nicht richtig angekommen ist. Eine Zeit der Unwirklichkeit, was vieles ganz normal erscheinen lässt, so, als würde das Leben weitergehen wie gewohnt, während doch alles gerade umstürzt. Gerrit Kouwenaar ist in Fall, Bombe, Fall das Kunststück geglückt, die Atmosphäre dieses Niemandslands auf fabelhafte Weise umzusetzen.
Die Novelle erzählt die Ereignisse, die sich in den Niederlanden im Mai 1940 zutragen, aus der Perspektive des siebzehnjährigen Karel, der mit ebenso pubertären wie gewalttätigen Phantasien dem Leser entgegentritt. Ein Auslöser ist die sexuelle Verlockung beim Anblick eines – wirklich wie im übertragenen Sinne – unerreichbaren Dienstmädchens, das Karel beobachtet.
Seine Auflehnung gegen die bürgerliche Welt und die elterliche Autorität zeigt sich in der gedanklichen Verweigerung, Beethovens »Ode an die Freude« zu mögen. Karel malt sich aus, wie er seine Ablehnung nicht etwa hinausposaunt, sondern im Gegenteil heuchelt, er fände die Musik herrlich. Er würde lügen, den Schein wahren. Eine Form, die elterliche Kontrolle auszusperren, die sich auf Äußerlichkeiten wie Pickel beschränkt, »den Rest kann niemand kontrollieren«.
Ich weiß, dass es verwerflich ist, zu wünschen, dass es Krieg gibt, aber ich fände es herrlich.
Gerrit Kouwenaar: Fall, Bombe, Fall
Dieser »Rest« besteht unter anderem aus dem Wunsch, dass er allmächtig wäre, verwoben mit den für ihn unerfüllbaren sexuellen Phantasien, aber auch mit handfesten Gewaltvorstellungen: Die gesamte Straße ginge in Flammen auf oder ein zufällig vorübergehender Junge stürbe. Über allem steht aber das eher unbestimmte Bedürfnis danach, dass etwas geschehe und die unerträgliche Stille verginge.
Ein Krieg würde die Stille vertreiben; eine fallende Bombe, wodurch sich der Titel der Novelle erklärt. Dabei ist zu diesem Zeitpunkt schon Krieg, Deutschland hat Polen angegriffen, England und Frankreich dem Aggressor den Krieg erklärt, ohne dass bis zu diesem Zeitpunkt im Westen Europas große Kämpfe ausgebrochen wären. Im Osten hat die Sowjetunion Polen und Finnland kriegerisch heimgesucht, quasi im Sichtschatten der Kriege Hitlerdeutschlands.
In den Niederlanden starrt man vorahnungsvoll nach Osten, die Erwartung lautet, dass man anders als 1914 angegriffen werde. Anspannung liegt in der Luft, in verschiedenen Maßnahmen, wie etwa eine Urlaubssperre, schlägt sich die Nervosität nieder. Karel aber erlebt zunächst einen Verwandtenbesuch, der die Handlung in Gang bringt: Sein Onkel Robert bittet ihn um die diskrete Überbringung eines Briefes an eine Frau mit dem exotischen Namen Mexocos.
Ich warte, und ich bin immer noch ein dicker, fröhlicher Mann, doch mein Glück ist in Gefahr.
Gerrit Kouwenaar: Fall, Bombe, Fall
Karels Onkel Robert kommt nicht mehr dazu, seinem Neffen zu erklären, was sein »Glück« ist und wodurch es in Gefahr gerät; die Auflösung lässt noch etwas auf sich warten, denn der Krieg kommt nun doch. Ein gleichmäßiges Brummen liegt in der Luft, »breite Streifen weißen Lichts« zucken »ungelenk« über den dunklen Himmel. Bald ist in der Ferne auch ein Grollen zu hören, »als gäbe es Gewitter«.
Die Nachrichten bringen die Bestätigung: Die »Deutschen haben uns überfallen«. Doch außer der Geräuschkulisse, die eben noch nicht mehr ist, macht sich der Krieg kaum bemerkbar. Karel streift durch die Stadt, die namenlos bleibt; er scheint auf der Suche zu sein, auf der Suche nach dem Krieg. Vor dem Leser entfaltet sich nun auf eine beeindruckende Weise jenes Niemandsland zwischen Frieden und Krieg.
Auf seinem Weg nimmt Karel Details wahr, die in einem seltsamen Spannungsverhältnis stehen. Sandsäcke werden aufgestapelt, eine Bürgerwehr ist durch Patrouillen präsent, es gibt Gerede über die Franzosen und Engländer, die bald kämen; am Himmel kann man Flugzeuge in perfekter Formation ausmachen, ungerührt von den sie umgebenden weißen Wölkchen (Flakfeuer); aber die Cafés sind voll, die Menschen genießen die Sonne, deren Leuchten zu der Nachricht des Überfalls nicht passen will. An einem Haus werden verschnörkelte Buchstaben neu lackiert. Das Gefühl macht sich breit, einer Illusion aufzusitzen.
Es passiert alles Mögliche, und es passiert nichts.
Gerrit Kouwenaar: Fall, Bombe, Fall
Bis der Krieg sein blutiges Haupt erhebt.
Dank des Briefes und des Auftrags, mit dem Karel durch seinen Onkel Robert beauftragt worden ist, lernt er zwei Rias kennen, Mutter und Tochter gleichen Namens, die eine gänzlich andere Existenz führen, als die Eltern der Hauptfigur. Es sind Künstler, Bohème, Jüdinnen, während die Familie Karels durch und durch bürgerlich, leistungsaffin und auf eine formelhafte Weise korrekt auftritt.
Die beiden Frauen sind sich der Gefahr durch die Deutschen bewusst und wollen darauf reagieren; Karel soll einen Antwortbrief an seinen Onkel überbringen. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Die Novelle ist von einer auf- und abschwellenden Dynamik geprägt, wie der Krieg selbst, der sich immer wieder nähert und in seinen Auswirkungen eskaliert. Das Leben Karels wandelt sich jäh, nicht nur in der Phantasie, denn er wird abrupt von der Kindheit in die Erwachsenenwelt gestoßen.
Die Novelle ist voller wunderbarer Formulierungen, atmosphärischer Passagen, Beobachtungen, Tempo- und Dynamikwechseln; ganz besonders gefallen hat mit Karels Gedankenflug, in dem er sich mit der Floskel, deutsche Truppen hätten die Grenze überschritten beschäftigt. Er fragt sich: Wie überschreitet man eigentlich eine Grenze? Und füllt diese hohle Formulierung mit erzähltem Leben.
[Rezensionsexemplar]
Gerrit Kouwenaar: Fall, Bombe, Fall
Aus dem Niederländischen von Gregor Seferens
Mit einem Nachwort von Wiel Kusters
C.H. Beck 2024
Hardcover 124 Seiten
ISBN: 978-3-406-81390-0