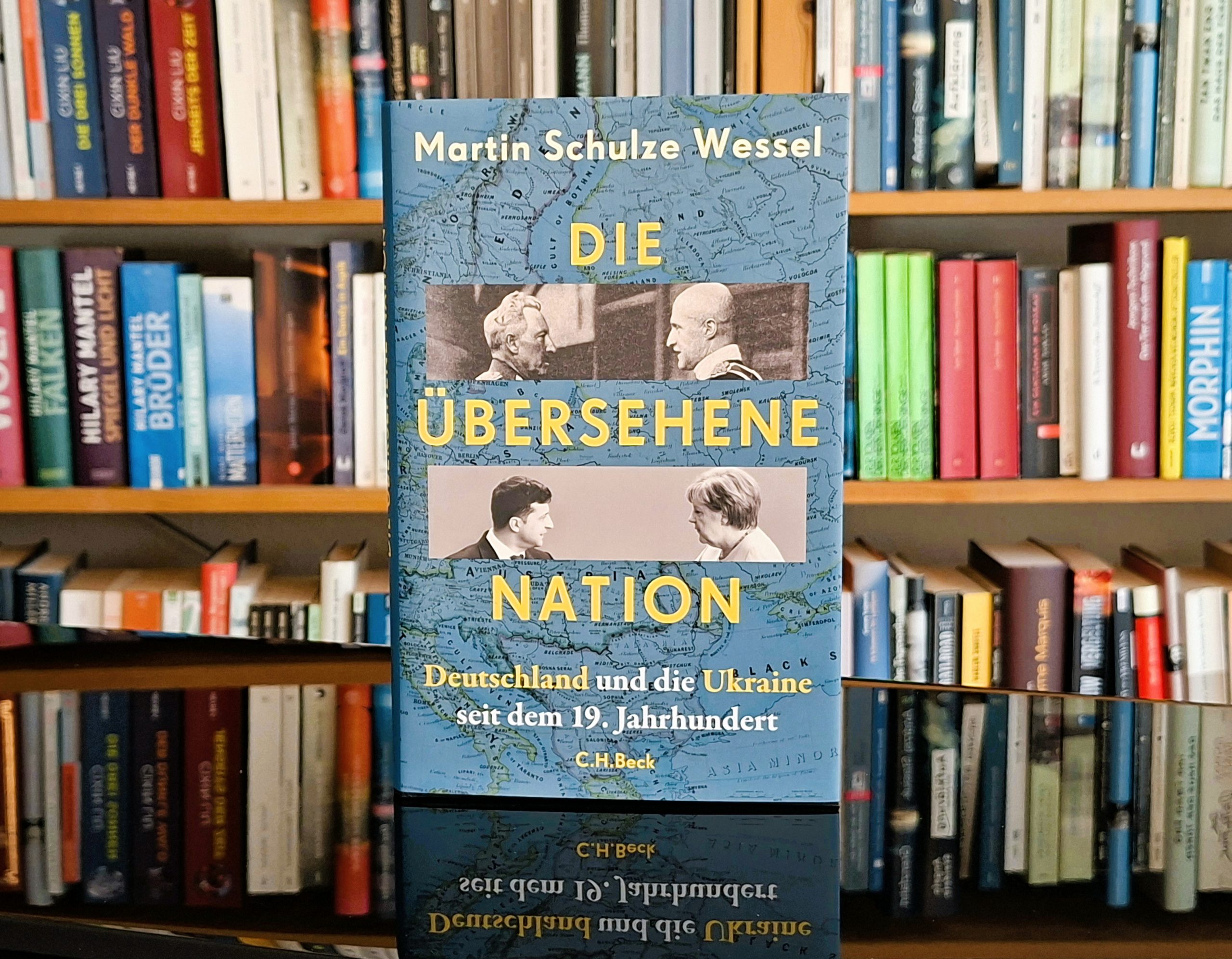Als passionierter Kaffeetrinker hat mich der Titel natürlich sofort angesprochen und selbstverständlich furchte sich meine Stirn bei der Frage: Wie kann man Kaffee stehlen? Besser gesagt: Warum sollte man Kaffee stehlen, wenn man ihn doch mehr oder weniger überall erstehen kann bzw. in der Welt, in der Hillenbrands Roman Der Kaffeedieb leicht erwerben konnte? Gut, das Angebot war geringer, es handelte sich um ein Luxusgut, aber wer würde ohne Not für einen Diebstahl die grausamen Strafen dieser Zeit in Kauf nehmen?
Es ist ein richtig guter Buchtitel, das machen meine einleitenden Worte schon deutlich, denn die offenen Fragen erzeugen Neugier und damit die Motivation, ein Buch lesen zu wollen. Die Erzählung, die Der Kaffeedieb zu bieten hat, konnte alle Erwartungen deutlich übertreffen. Das beginnt schon mit der Notlage, in die sich der Held Obediah Chalon bringt. Als alter Börsianer weiß ich es sehr zu schätzen, wie er sich verspekuliert und auch noch mit gefälschten Wechseln. Herrlich!
Auch die Strafe, die er erdulden muss, ist sehr originell – sie dient als klassische Mausefalle für einen Gestrauchelten, der so vor eine Wahl gestellt wird, die gar keine ist: Obediah muss einen Auftrag annehmen, der einem Himmelfahrtskommando ohne sonderliche Aussichten auf Erfolg gleicht. Sein Auftraggeber ist zudem für seine brutale, gewissenlose Grausamkeit bekannt: die Niederländische Ostindienkompanie. Kompanie meint hier: Gesellschaft.
Obediah nimmt nolens volens an. Eine haarsträubende Geschichte voller abenteuerlicher Wendungen, Begegnungen, beinahen und tatsächlichen Katastrophen, Rückschlägen und überraschenden Fortschritten, Verfolgungen, Schleichwegen, ausufernden Plänen und Absichten, Zufällen und Gefahren in mehr oder weniger fremden, immer gefährlichen Ländern entwickelt sich. Alles, um Kaffee zu stehlen – da ich nicht gern spoilere, belasse ich es bei einer nichtssagenden Angabe: Es geht um mehr als eine Schale voll lauwarmer Kaffee-Plörre.
Der Kaffeedieb besticht durch die Gestaltung seiner Hauptfigur. Ein Virtuoso, weitreichend vernetzt mit anderen Gelehrten dieser Zeit, in der Newton, Leibnitz und wie sie alle hießen das Wissen der Menschheit von den Tumbheiten religöser Eiferei befreiten und auf eine rationale Grundlage stellten. Briefe wurden verfasst und empfangen, man könnte meinen, es hätte so etwas wie einen Gelehrtenstaat gegeben, basierend auf dem Wort, der Schrift und dem Gedanken.
Das gibt dem Roman die gewisse Würze und bewahrt Leser wie mich vor dem bloßen Action-Gedöns – das ich nur selten zu schätzen weiß. Manche mögen das vielleicht als geschwätzig, weitschweifig und langatmig empfinden, weil nicht alle zwei Seiten die Säbel gekreuzt werden und die Kanonen donnern, sondern nachgedacht, gestritten, debattiert und aufgeklärt wird.
Und, ja – da wäre noch der Höhepunkt der Erzählung, wenn der gewagte, gewundene Plan in die Tat umgesetzt wird und Hillenbrand einfach die Perspektive wechselt. Das Spektakel wird in der Rückschau von einem alt gewordenen Augenzeugen berichtet, der seinen Zuhörern, einer Schar Kinder, eine recht eigenwillige Auslegung der Ereignisse darbietet. Der Leser weiß genug, um das alles auf die Pläne Obediahs übertragen zu können – den Rest muss er sich halt selbst ausmalen. Chapeau!
Es gibt Motive in Romanen (und Filmen), die eine Kaminfeuerwärme bei mir erzeugen. Die Zusammenstellung einer Gefährtengruppe gehört dazu. Obediah kann das Unternehmen nicht allein bewältigen, er braucht Unterstützer, die bei so einem Unternehmen nicht gerade zu der sozialverträglichsten Sorte gehören. Der Kaffeedieb schart seinen Trupp eigenwilliger Persönlichkeiten um sich und muss mit ihnen klarkommen – bis zum bitteren Ende. Auch das ist übrigens in jeder Hinsicht sehr gelungen.
Tom Hillenbrand: Der Kaffeedieb
Kiepenheuer&Witsch 2016
Gebunden 480 Seiten
ISBN: 978-3-462-04851-3