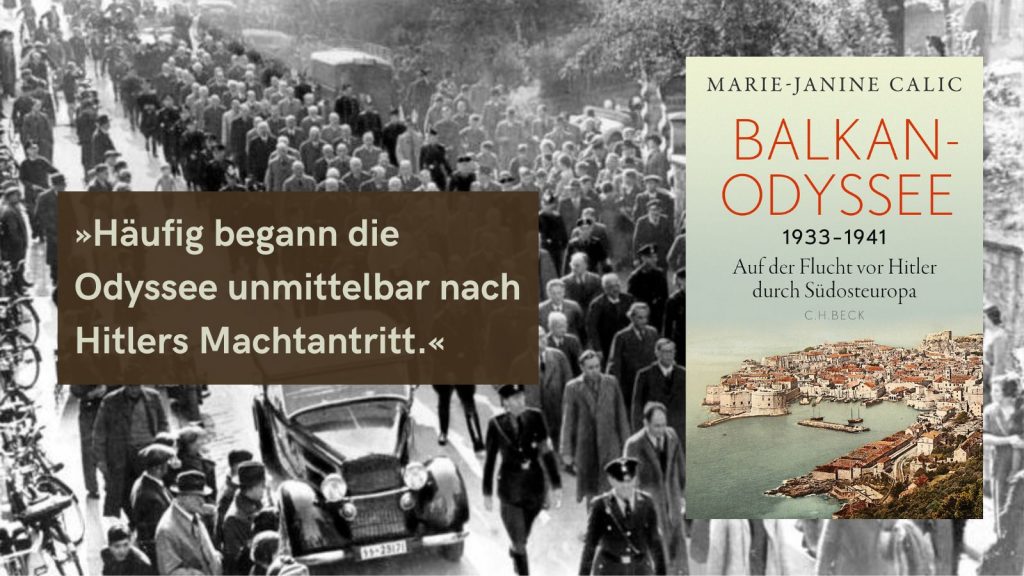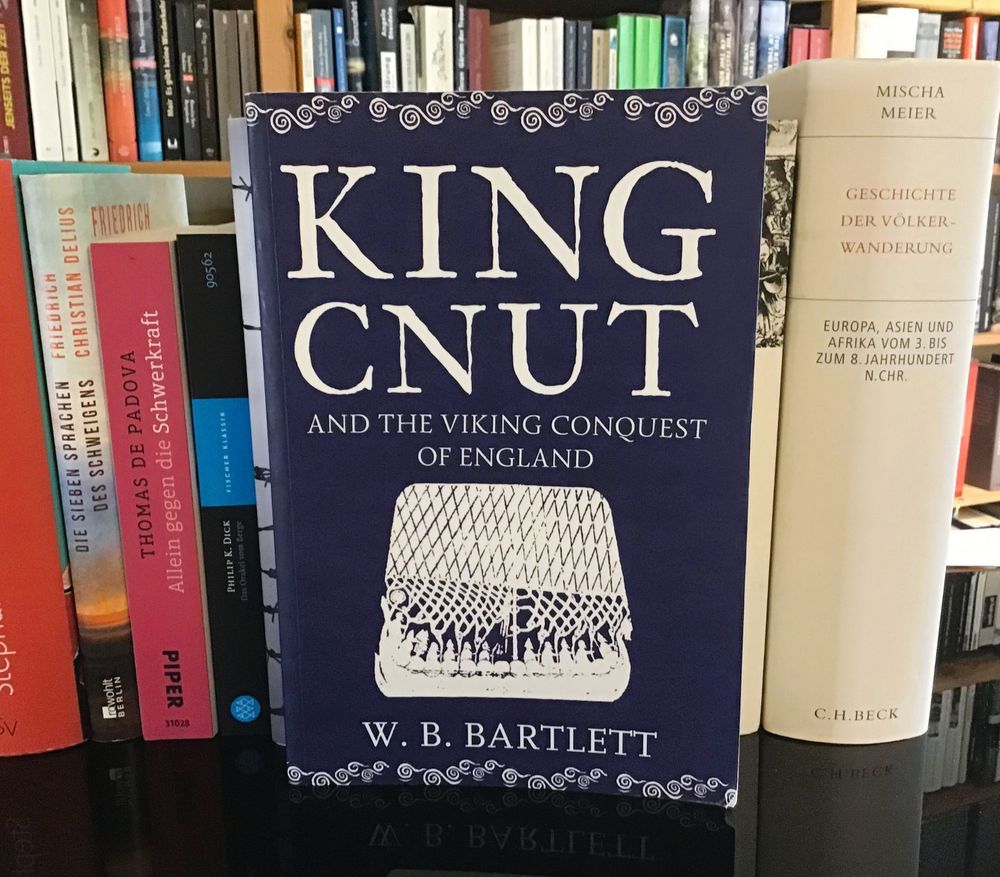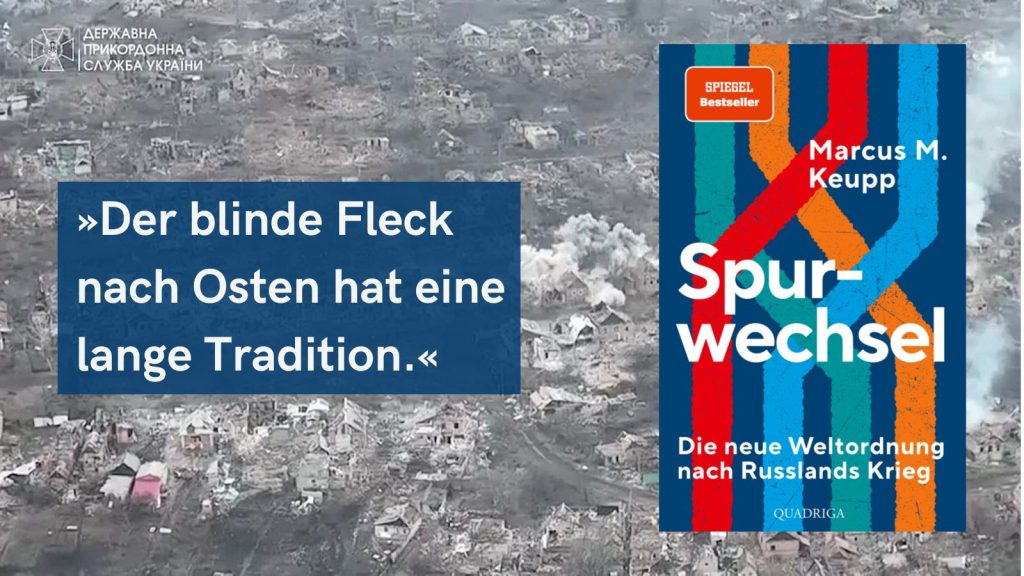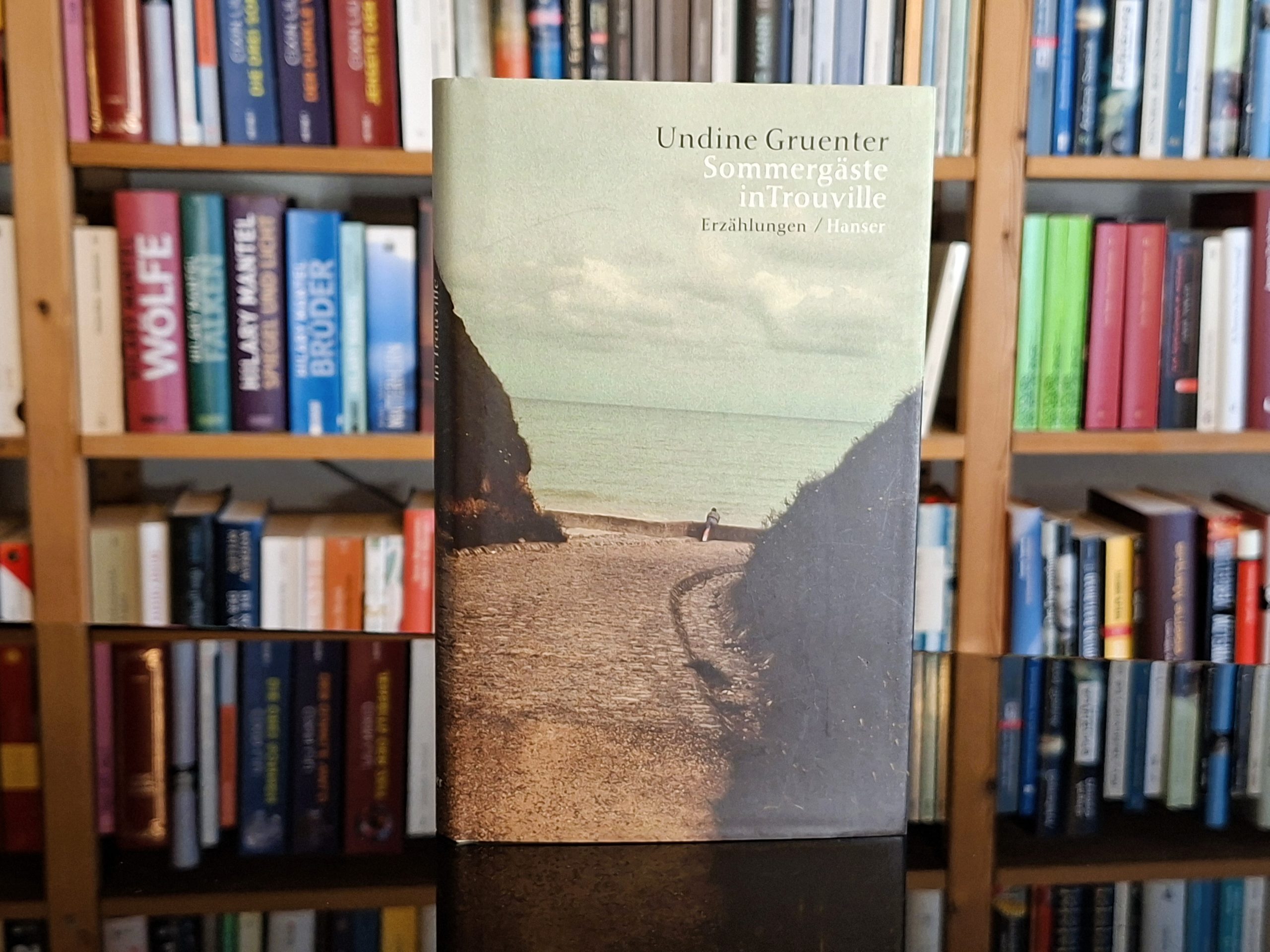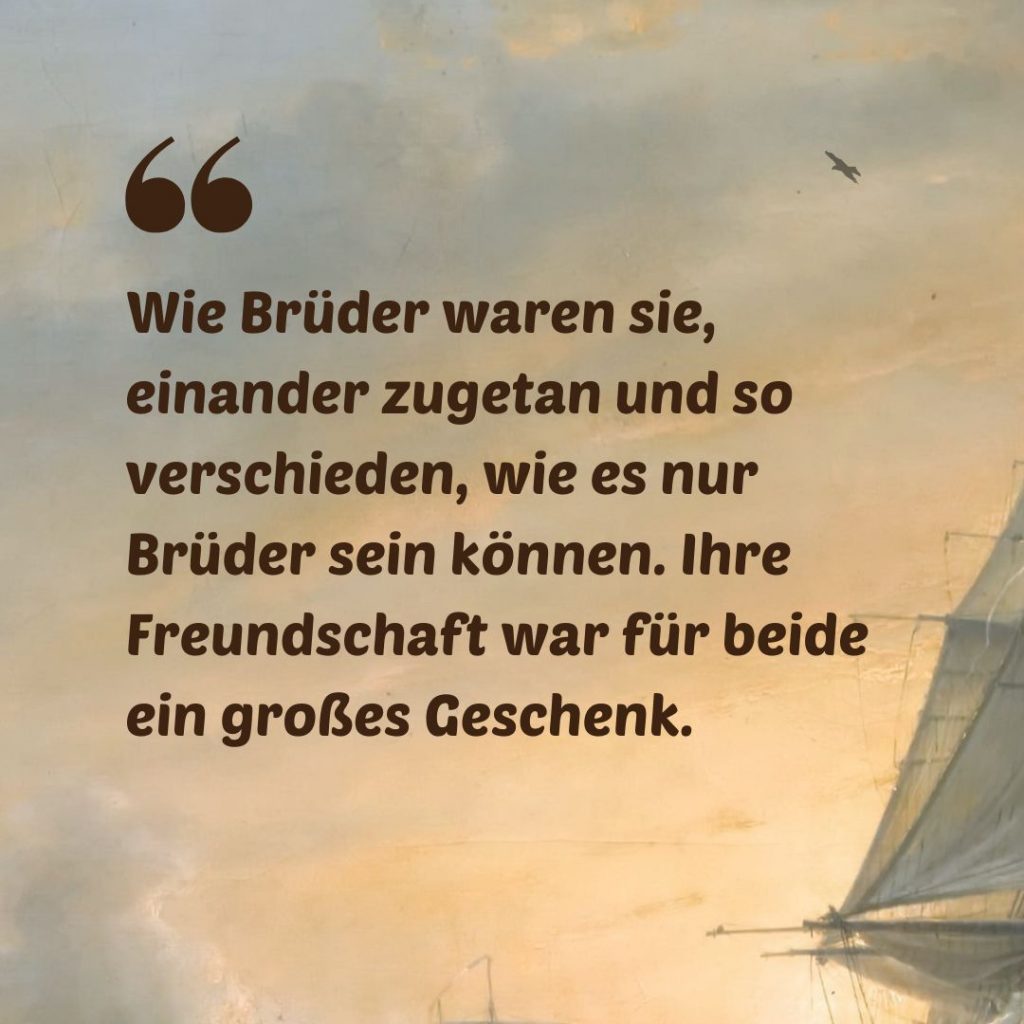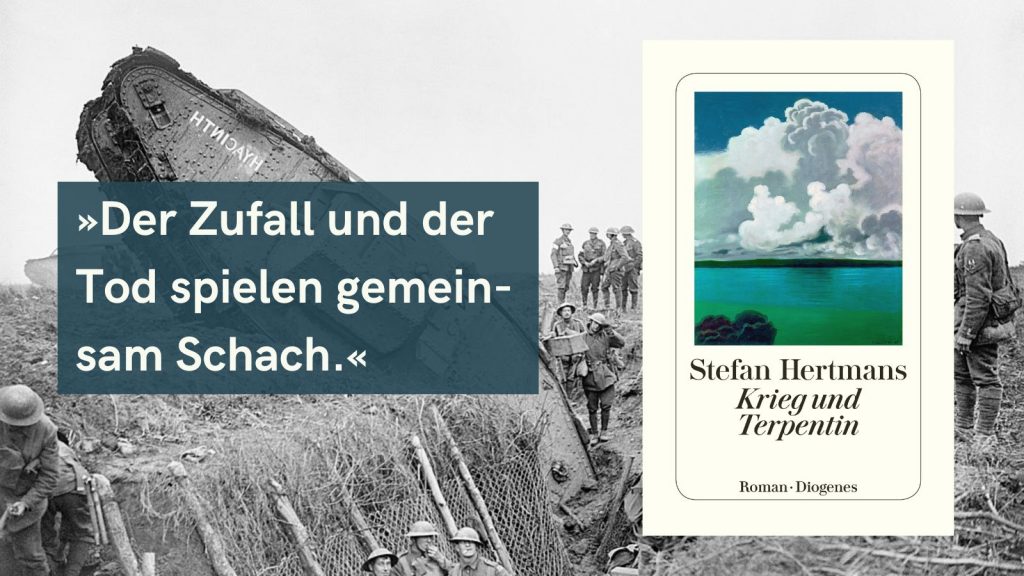
Fast zweihundert Seiten verstreichen, ehe der »Große Krieg« ausbricht. Der Großvater Stefan Hertmans’ muss ins Feld ziehen, wie man euphemistisch sagt; was er dort erlebt, schreibt er Jahrzehnte später nieder und gibt die Blätter an seinen Enkel weiter. Mit der Gabe ist ein Auftrag verbunden, so zumindest versteht es Autor Hermans, sich mit den Erinnerungen an das blutige Massenmorden auseinanderzusetzen. Krieg und Terpentin ist das Resultat dieser Auseinandersetzung, in der die Kriegserinnerungen den eisenharten Kern darstellen. Das Buch geht jedoch weit über die Kriegszeit hinaus, es ist auch eine Familien- und Generationengeschichte, eine Spurensuche mit verblüffenden Funden und vielen Sackgassen.
Im historischen Bewusstsein Deutschlands ist der Erste Weltkrieg im Schatten des monströsen Zweiten Weltkrieges verschwunden; Vernichtungskrieg, Holocaust und Selbstzerstörung verschlucken alles Vorangegangene. In Frankreich ist das anders, hier spielt – vielleicht auch durch die verheerende Niederlage der französischen Armee 1940 – der »Große Krieg« in der Erinnerung eine bedeutende Rolle. Und in Belgien? Auch nach der Lektüre von Krieg und Terpentin kann ich darauf keine Antwort geben. Aber in den Erinnerungen von Urbain Martien (und seines Enkels Stefan Hertmans) nimmt der Erste Weltkrieg eine zentrale Rolle ein, der Zweite Weltkrieg ist kaum mehr als eine Randerscheinung.
Meine Kindheit ist überwuchert von seinen Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg, immer und immer wieder dieser Krieg.
Stefan Hermans: Krieg und Terpentin
Das ist verblüffend für einen deutschen Leser, doch in gewisser Hinsicht folgerichtig. Mit dem Kriegsbeginn begann der rasante Absturz jener Welt von Gestern, wie die Zeit bis 1914 nach Stefan Zweig noch heute genannt wird. Diese Disruption war ein blutiges Beben und wischte eine bis dahin nur in Teilen angegriffene Gesellschaftsordnung mit brutaler Rasanz hinweg. Mit ihr verschwanden nicht nur verkrustete, rückständige und menschenverachtende Strukturen, sondern auch moralische und persönliche Hemmnisse. Der mechanisierte Krieg mit seinen ungeheuren Verlusten und Massen-Tötungsmitteln (Gas) machte bis dahin Undenkbares möglich, auf dem Schlachtfeld und im Zivilleben. Ohne diese Radikalisierung wären die ideologischen Massenmorde im Gewand des Bolschewismus, Nationalsozialismus und Maoismus schwerlich möglich gewesen. In diesem Sinne war der Erste Weltkrieg die Urkatastrophe.
Stefan Hertmans widmet der Zeit vor diesem Desaster mehr Raum als dem Krieg an sich. Er nähert sich dem Menschen Urbain Martien über seine persönlichen Erinnerungen an und greift von dort weit in die Vergangenheit zurück. Die Lebenslinien der Urgroßeltern bilden den zeitlich am weitesten zurückliegenden Stoff für Krieg und Terpentin. Mit ihnen tritt nicht nur der Großvater ins Leben, das Leben selbst wird anhand der Schicksale geschildert. Diese Welt ist jenseits der romantisierten Erinnerungen Stefan Zweigs oder auch in Joseph Roths Radetzkymarsch brutal und gnadenlos. Die an Krebs erkrankte Nachbarin verreckt langsam und qualvoll an ihrem Tumor, der weder behandelt noch schmerzlindernd mit Medikamenten begleitet wird. Die Arbeitsverhältnisse (einschließlich horrender Unfälle) sind geradezu absurd in ihrer Menschenfeindlichkeit, die gesellschaftliche Kluft zwischen Arm und Reich dramatisch.
Es ist das Hin-und-Hergerissen-Sein zwischen dem Soldatensein aus Not und dem Künstlerdasein aus Neigung: Krieg und Terpentin.
Stefan Hermans: Krieg und Terpentin
Doch geht etwas verloren, wie sich am Großvater zeigt, der später immer etwas altmodisch wirkt, in einem positiven, wenngleich schwierigen Sinne. Mehrfach kommt es zu psychischen Krisen, Einweisungen in Kliniken und Behandlungen mit Elektroschocks. Traumatherapie gab es noch nicht, dabei wäre sie nötig gewesen, angesichts der Kriegserlebnisse und dem kaum weniger niederschmetternden privaten Tiefschlag während der mörderischen Spanischen Grippe 1919. Infolge der Kriegsversehrungen scheidet Urbain Martien früh aus dem Arbeitsleben aus und widmet sich dem Malen. Die Kunst spielt eine wesentliche Rolle in dessen Leben, brotlos, aber kreativ und produktiv. Hertmans Spurensuche kommt auch dank der Bilder zu überraschenden Erkenntnissen über seinen Großvater, die Gemälde sind wie Schlüssel zu den geheimen Kammern voller Schmerz und Trauer.
Ich war während der Lektüre verblüfft über die oft abfällig behandelten Kopien von berühmten Bildern. Schon bei Rebecca Struthers Uhrwerke werden Nachahmungen und Fälschungen von Uhren, Kunstwerken anderer Art, in einem helleren Licht gezeichnet. Auch im Leben von Wolfgang Herrndorf bildete die Nachahmung alter Meister einen wesentlichen Aspekt. Urbain Martien hat sie in seinem Sinne für die Bewältigung seiner ganz persönlichen Verheerungen verwendet. Kurioserweise ist kein einziges Kriegsbild unter seinen Werken, obwohl er in seinen Erinnerungen davon spricht, im Schützengraben gezeichnet zu haben. Hier mussten es Worte richten. Sie erinnern an das, was man bei Remarque und anderen Kriegsliteraten lesen kann, sind aber doch grundverschieden, denn hier schreibt ein Flame über seine Zeit in der belgischen Armee. Die erscheint in keinem guten Licht, wie sich nicht nur an der Behandlung der flämischen Soldaten durch die frankophonen Offiziere zeigt.
Logik des Schlachtfeldes. Der Zufall und der Tod spielen gemeinsam Schach.
Stefan Hermans: Krieg und Terpentin
Urbain Martien überlebt den Krieg, er wird mehrfach schwer verwundet und ausgezeichnet, anders als seine wallonischen Kameraden aber nicht zum Offizier befördert. Eine lebenslang nachwirkende Herabsetzung, nicht die einzige für die flämischen Soldaten. Seine Genesungsaufenthalte, unter anderem in England, sind verwaschene Flecke in der Biographie, aus dem unscharfen Bild schält sich die grotesk erscheinende Sehnsucht nach dem Graben und den Kameraden heraus. Der Krieg zerrüttet Mensch und Land. Hertmans bereist die Schlachtfelder, jene Orte, an denen sein Großvater gekämpft hat. Die Spuren sind verschwunden, es hat den Anschein, als ob die Gegenwart in einem ganz anderen Land angesiedelt wäre. Eine Scheinwelt, denn als der autofiktionale Roman 2013 erschien, konnte man noch wähnen, der Krieg wäre überwunden. Ein Jahr später machte Putins Russland den Irrtum offenkundig, was viele bis 2022 ignorierten. Der Krieg war nur verborgen, aber nie weg.
Stefan Hermans: Krieg und Terpentin
Aus dem Niederländischen von Ira Wilhelm
Diogenes 2018
Taschenbuch 416 Seiten
ISBN: 978-3-257-24431-1