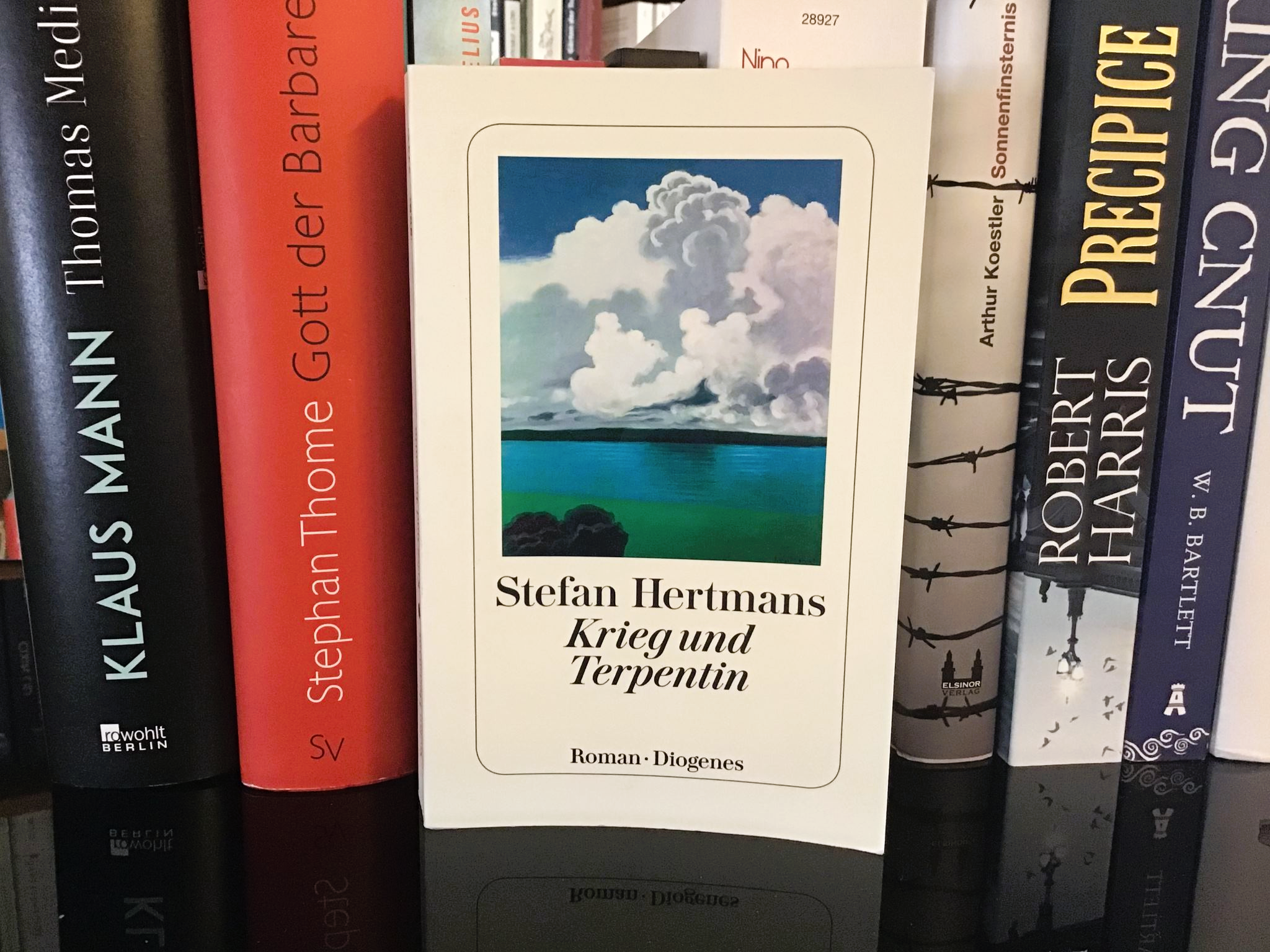Ein eher stiefmütterliches Dasein fristet die große europäische Revolution von 1848/49 im Geschichtsunterricht, möglicherweise auch im Studium des Faches. Vor derartigen Verallgemeinerungen sollte man sich normalerweise hüten, doch in diesem Fall gibt es einen guten Grund für das relative Desinteresse: Der Zivilisationsbruch nach 1933, dessen Gespenster auch nach der Niederlage von 1945 keineswegs verschwunden sind, ja, sogar wiederzukehren scheinen, überschattet mehr oder weniger alles andere in der deutschen Geschichte.
Höchste Zeit also, dass sich etwas daran ändert, nicht um die Schreckenszeit zwischen 1933 und 1945 zu relativieren, sondern sich von einer ganzen Reihe von allzu bequemen Irrtümern und naiven Klischees verabschieden. Christopher Clark hält in seinem monumentalen Werk Frühling der Revolution eine ganze Reihe von Zumutungen parat, die Sonderwegs- und Revolutionsphantasten gleichermaßen aufstoßen werden.
Clark richtet den Blick bewusst auf Europa, von Portugal bis zur Walachei bzw. Moldau. Er verzichtete darauf, sich der herkömmlichen nationalen Sichtweise anzuschließen und ebenso, die Februarrevolution in Frankreich als alleinigen und ausschlaggebenden revolutionären Ausgangsimpuls anzusehen – wie es zum Beispiel in einer Karte des frankozentrierten Altas Die Geschichte der Welt von Christian Grataloup geschieht.

Los geht es in – Palermo, nach einem Vorspiel in der Schweiz, dem so genannten Sonderbundskrieg 1847. Der Aufruhr in Sizilien Anfang 1848 war der eigentliche Impuls, Clark weist nach, dass davon in vielen Regionen Europas durchaus öffentlich die Rede war und eben nicht nur von den Ereignissen in Paris. Durch die Kommunikationskanäle jener Jahre mit einer Zeitverzögerung, die heute geradezu grotesk erscheint. Danach geschieht vieles gleichzeitig und zum Teil auch gegenläufig.
Ab Anfang März 1848 ist es unmöglich, die Revolutionen als lineare Abfolge von einem Schauplatz zum nächsten zu verfolgen. Wir treten in die Phase der Spaltung ein, in der fast gleichzeitige Explosionen komplexe Rückkopplungsschleifen entstehen lassen.
Christopher Clark: Frühling der Revolution
Durch diesen Ansatz ist es nahezu unmöglich, die Ereignisse chronologisch abzubilden – möglicherweise liegt hierin auch eine der Verlockungen der späteren Nationalisierung der Revolutionsgeschichte(n), mit erheblichen Folgen: Die Komplexität der Ereignisse und – ganz wichtig – ihre Verbindungen und gegenseitigen Beeinflussungen, aber auch die gleichzeitig an verschiedenen Orten ausbrechenden Empörungen verschwanden hinter dem Wahrnehmungshorizont.
Das ist nicht nur bedauerlich, sondern für die Gegenwart und das Verständnis von welterschütternden Ereignissen nachteilig. Clark hält den Februar 1848 für einen Tahir-Moment! Er stellt den so genannten »Arabischen Frühling« in eine Bedeutungslinie mit der großen europäischen Revolution von 1848/49. Beiden ist neben vielem anderen auch gemein, dass sie die Ziele der politischen, gesellschaftlichen und religiösen Emanzipation nicht erreicht haben.
Dennoch stellt sich die Frage, ob es nicht zu kurz greift, wenn man von einem Scheitern spricht, gar nicht zu reden von jenen, die den Aufständischen oder gar den »Völkern« dieser Region mangelnde Reife attestieren. Der Vorwurf der Unreife war bereits von 175 Jahren ein Mittel, mit dem Forderungen nach Emanzipation aller Art abgebügelt wurden.
Wie also sollte man die Revolutionen von 1848/49 bewerten?
War es wirklich nur eine jämmerliche Parodie der Revolution von 1789, wie Karl Marx meinte, oder sollte man dem bärtigen Kommunismus-Gläubigen unlautere Motive bei seiner Einschätzung unterstellen? Überhaupt ist Clarks Buch eine gute Anregung zum Weiterdenken – wie steht es allgemein mit Revolutionen und (gesellschaftlichem) Fortschritt? Waren die Revolutionen 1917/18 in diesem Sinne erfolgreich? Jene von 1989? Gab es jemals eine »erfolgreiche« Revolution?
Soziale Unzufriedenheit ›verursacht‹ keine Revolution – wenn sie das täte, käme es viel häufiger zu Revolutionen.
Christopher Clark: Frühling der Revolution
Die europäische Revolution von 1848/49 ist nicht im luftleeren Raum entstanden. Clark zeichnet eine Reihe von Entwicklungen in den Jahrzehnten vor dem umfassenden Aufruhr nach. Der so genannte »Pauperismus« etwa gilt vielen als wichtiger Faktor oder gar der Auslöser der Revolution, dem Clark jedoch widerspricht. Während der Lektüre verfestigt sich eher der Eindruck, dass die soziale Frage vor allem bremste, Ängste bei liberalen Kräften auslöste und diese die Seiten wechseln ließ, mit verheerenden Folgen für den Verlauf der Revolution.
Schon bei diesem Zusammenhang wird klar, wie erkenntnisfördernd Clarks Vorgehen ist. Er arbeitet die großen Unterschiede heraus, die zwischen den Regionen Europas bestanden und zeigt, dass es eben keine direkte Linie zwischen den zum Teil verheerenden sozialen Auswirkungen der Hungersnöte 1847 und dem Revolutionsausbruch 1848 gegeben hat. Bedeutungslos waren sie nicht, allein der Faktor Angst beeinflusste den Revolutionsverlauf beträchtlich.
»Arme dulden« und machen keine Revolution. Wer aber dann? Eine Revolution ist politisch, also müssen politisch denkende und agierende Menschen dafür verantwortlich sein. Es gab zwischen dem Sieg über Napoleon Bonaparte und 1848 zahlreiche Aufstände, Erhebungen, Umstürze und Revolutionen, viele davon wurden wie Verschwörungen geplant und durchgeführt – der Staat wappnete sich mit Polizei und Militär geschickt dagegen. Aber 1848/49 half das wenig, denn mit den Massen, die den politischen Protestaktionen spontan in die öffentlichen Räume folgten, hatte man nicht gerechnet.
Das Militär und die Polizei in Paris – wie in vielen anderen Städten in ganz Europa – hatten sich in den vergangenen 18 Jahren auf die falsche Revolution vorbereitet.
Christopher Clark: Frühling der Revolution
Clark erklärt vor seiner Schilderung der Revolutionsereignisse zunächst einmal ausführlich jene Welt vor 175 Jahren. Bei den Ordnungskonzepten erwies sich ausgerechnet die Macht des Mannes über die Frau, insbesondere in der Ehe an, als unantastbar, während andere Bastionen zumindest ins Wanken gerieten: Feudalismus, Adelsprivilegien, Zunftrechte, Sklaverei. Die »geschlechtsbedingte Ungleichheit [wehrte] sich am hartnäckigsten gegen jede Veränderung.« Eine ebenso ernüchternde wie bittere Erkenntnis.
Bei dem Versuch, rückblickend Ordnungsprinzipien bzw. -gruppierungen zu erdenken, macht das disparate und von hoher Mobilität gekennzeichnete Verhalten Probleme. Es fällt schwer, zum Beispiel »Liberale«, »Demokraten« oder »Radikale« genau zu fassen; selbst »Konservative« unterschieden sich grundlegen. Ein Konservativer, der Revolutionäre für irregleitet hält, ist grundverschieden von einem, der in ihnen »satanische Rebellen gegen Gott« sieht.
Die französische Revolution von 1830 ist tatsächlich eine Art Initialzündung für nachahmende Aufstände in Italien, Polen und Deutschland gewesen, die massive Enttäuschung bezüglich der Ergebnisse führte zu politischen Oppositionsbewegungen in den Jahren danach. Es entspann sich ein reges Katz- und Mausspiel zwischen Opposition und Staat, das in Palermo am 12. Januar 1848 jäh endete und in einen Aufstand mündete, der zuvor per Plakat (!) angekündigt wurde.
Das ist nur die erste der an Kuriositäten reichen Geschichte der europäischen Erhebungen 1848/49, die insgesamt zeigen, wie dünn der Firnis ist, der eine scheinbar stabile Ordnung von ihrem Untergang trennt. Warum führte ausgerechnet die Revolutionen von 1848 zu einem – recht kurzen – Erfolg, nachdem so viele Anläufe zuvor scheiterten? Eine Antwort:
Liberale waren ausdrücklich keine Demokraten; sie waren überzeugte Anhänger eines begrenzten Wahlrechts.
Christopher Clark: Frühling der Revolution
Ein Blick nach England, das sich irrigerweise im Glauben wähnt(e), eine selbst angedichtete liberale Verfassung hätte einen Aufstand mehr oder weniger unnötig gemacht, offenbart die Bedeutung von umfassenden und geeigneten Sicherheitsmaßnahmen. Knüppel in großer Zahl haben auf der Insel schon den Aufruhr im Ansatz niedergehalten und hätten dank schierer Masse auch weiterreichende Ansätze erstickt, argumentiert Clark.
Das Regime in Großbritannien war besser vorbereitet als die auf dem Kontinent. Clark sagt mehrfach, dass man etwa in Frankreich auf den falschen Aufstand eingestellt war, in Deutschland waren die geheimdienstliche Gegenmaßnahmen vor 1848 sehr erfolgreich, dann aber zunächst nicht mehr. Für die Gegenwart lässt sich daraus die Lehre ziehen, dass die Erhebung 2020 in Belarus mit geringen Chancen in die Schlacht zog, stand hinter Lukaschenko doch Putin und ein ruchloses, erprobtes und ausgeklügeltes Repressionsmanagement.
Die Revolutionen von 1848/49 sind in eine erfolgreiche Gegenrevolution übergegangen, was durchaus als »Scheitern« interpretiert werden kann. Wer Clarks Darstellung aufmerksam folgt, merkt bereits während der Phase der Etablierung der neuen Revolutionsherrschaft, dass dieses »Scheitern« bereits hier seinen Anfang nimmt. Ein Beispiel: Steuern sind unbeliebt, aber nötig, um zu regieren; sie wirken aber wie Wasser und Sand auf das revolutionäre Freudenfeuer und führen zu Streit unter den Revolutionären.
Noch problematischer war der Gegensatz zwischen Stadt und Land, der verschärft wurde, durch eine leichtfertige und hartnäckige Ignoranz gegenüber den Verhältnissen außerhalb der urbanen Zentren – dort aber wohnte, arbeitete und litt die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung. Sie ging den revolutionären Bewegungen rasch verloren, auch dort, wo die Landbevölkerung gegenüber den Erhebungen grundsätzlich positiv eingestellt war, weil ausnahmsweise von den Revolutionären auf die wenigen Einsichtsvollen gehört wurde. Aber auch in diesen Fällen ließen sich komplexe, vertrackte und von den bisherigen Privilegierten bis aufs Blut bekämpfte Strukturen nicht so einfach durch bessere ersetzen.
In Neapel zeigte sich, dass die Konterrevolution noch ein paar Asse im Ärmel hatte.
Christopher Clark: Frühling der Revolution
Ein ganz wichtiger Faktor, der bisweilen übersehen wird, ist die Stärke der Reaktion, der Konservativen, Adeligen, Monarchen und vor allem anderen: des Militärs. Einmal nur, in Baden, sind reguläre Truppen in nennenswerter Zahl auf die Gegenseite gewechselt, was 1849 zu einer ausgedehnten militärischen Kampagne mit großen Schlachten führte. Ungarn wäre vielleicht auch noch zu nennen, da waren die Verhältnisse jedoch anders und noch viel komplexer als in Süddeutschland. In beiden Fällen waren die Aufständischen der Gegenrevolution militärisch hoffnungslos unterlegen.
Die Verlässlichkeit des Militärs (und des Polizeiapparates) ist das vielleicht größte Plus gewesen, auf das sich die Gegenrevolution im Verlauf der Revolution stützen konnte. Dem hatten die Aufständischen nichts entgegenzusetzen, sie schwächten sich vielmehr selbst und spalteten sich entlang der scharf gezeichneten Bruchlinien auf. Psychologisch war die Revolution am Ende, als sie sich selbst entzauberte, indem sie ihr Angstpotential einbüßte. Das geschah wieder nicht in Paris oder Berlin, sondern in Neapel.
Zu den Kuriositäten, die auch Anfang des 21. Jahrhunderts nachdenklich machen sollten, gehört, dass es den Konterrevolutionären gelang, das Volksempfinden auf ihre Seite zu bringen. Clark zeigt wunderbar auf, wie auf das »Abflauen der Revolution« eine verblüffende »Mobilisierung des Volkes gegen sie« folgte. Das entspricht nun gar nicht den Bullerbü-Versionen von Revolutionen, wie sie in Romanen und Filmen so gern transportiert werden.
Überall in Europa waren Schaulustige und Dummköpfe entscheidend für die wechselhafte Mechanik der Machtverhältnisse.
Christopher Clark: Frühling der Revolution
Auch sind die Vorgänge um die Wahl Louis-Napoléon Bonapartes zum Präsidenten Frankreichs am 10. Dezember 1848 in höchstem Maße bedenklich. Es war ein völlig unerwarteter Erdrutschsieg, in dem Bonaparte fast drei Viertel (!) der Stimmen erhielt. Das Ergebnis wurde vorher als unwahrscheinlich erachtet, im Nachhinein als unvermeidlich dargestellt. Die Kalkulation der vorgeblich klugen, einsichtigen Konkurrenten waren offenkundig grundfalsch. Da der Mensch sich nicht ändert, dürfte derlei auch der der Gegenwart wieder vorkommen. Und wer dächte jetzt nicht an Trump?
Interessant ist auch, dass Russland während des voluminösen Buches recht wenig Raum einnimmt und wenn, dann in der Rolle der konterrevolutionären Interventionsmacht. Die konservativen und reaktionären Kreise des Landes, aber auch die Linken, Progressiven wandten sich massiv gegen »den Westen«, aus unterschiedlichen Motiven, doch mit allzu vertrauten Argumenten und der Erkenntnis, die man immer wieder berücksichtigen sollte: Russland gehört(e) nicht zu Europa.
Der Frühling der Revolution von Christopher Clark ist ein herausragendes, monumentales, vielschichtiges und hervorragend argumentierendes Werk über die Revolutionen von 1848/49 in Europa, das dem Leser allein durch seinen Umfang einiges abverlangt. Der Autor schreibt in einer fesselnden Weise, bleibt dabei differenziert und klar, was es enorm erleichtert, die Entwicklungen an so vielen Schauplätzen nachzuvollziehen. Die Zeit, die es braucht, ist gut investiert, denn man versteht die Vergangenheit und Gegenwart sehr viel besser, weil man die richtigen Fragen stellt.
[Rezensionsexemplar]
Christopher Clark: Frühling der Revolution
Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz,Klaus-Dieter Schmidt, Andreas Wirthensohn
Hardcover 1.168 Seiten
mit 42 s/w-Abbildungen und 5 Karten
ISBN: 978-3-421-04829-5