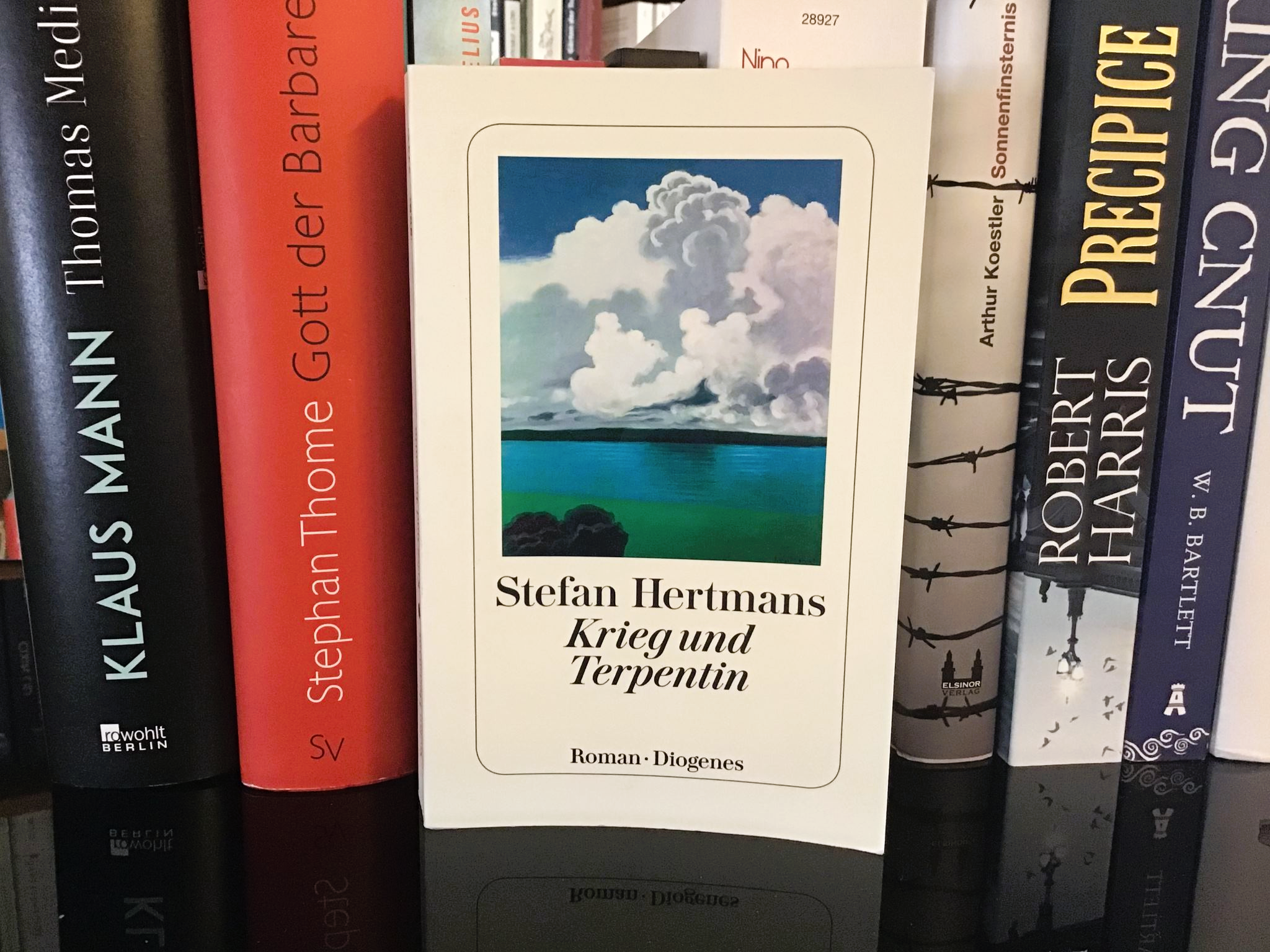Aus der Ferne erscheinen die Dinge immer einfacher, als sie in Wirklichkeit sind. Eine Binsenweisheit, die – wie so vieles andere – in Kriegszeiten aus dem Blick geraten kann. Vor allem, wenn es um jene Ferne geht, die nicht mehr so ohne Weiteres erreicht werden kann, weil man gut beraten ist, im Wortsinne jede Nachricht, jede offizielle Äußerung als Lüge zu betrachten.
Man darf dem Verlag edition fotoTAPETA dankbar sein, dass er Bücher wie »Das ist ein Ozean aus Wahnsinn« realisiert, denn die kritischen Stimmen zum Krieg aus Russland und Belarus sind wie ein kleines Fenster, das geöffnet wird und einen schmalen Spalt bietet, um Einblick zu erhalten in jene Lebenswelt, die in deutschen Medien oft nur in nichtssagenden, verallgemeinernden Sätzen Ausdruck finden.
Was heißt es eigentlich, wenn jemand Russland verlassen muss? Zunächst einmal bedeutet das, dass es sich um eine oder mehrere Personen handelt, die sich nicht aus Jux und Feriensehnsucht im Westen aufhalten, während sie gleichzeitig Putin unterstützen, was zurecht äußerst kritisch gesehen werden muss. Es sind Bewohner der Russischen Föderation, die unter dem Druck der Repressionen dieser Diktatur keine Zukunft haben.
Wir verstehen nicht, was mit uns geschieht, welche Epoche wir konkret haben.
Dekoder (Hrsg.): »Das ist ein Ozean aus Wahnsinn«
Es ist bedrückend, die Auszüge des Tagebuchs von Xenia Luschenko zu lesen, in denen sie ihre Erschütterung über den Kriegsausbruch, die panische Angst um ihren Sohn, den sie ans Exil verliert, die zunehmende Isolation im Land angesichts der fliehenden Freunde und die brutale Machtdurchsetzung des Regimes an ihre Hochschule beschreibt. Die Zeitgenossen tun, als ob alles normal wäre oder geben sich opportunistisch: ein „Z“ ans Revers, kein Problem.
In diesem ganz vorzüglichen Sammelband kommen sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen aus Belarus und Russland zu Wort, die eine Facette, einen Ausschnitt dessen beschreiben, was sich hinter dem Wort „Krieg“ verbirgt. Manche Dinge ähneln sich, etwa das Gefühl der Scham, des schlechten Gewissens gegenüber den mit Zerstörung und Vernichtung überzogenen Ukrainern. Das war ganz besonders intensiv in Natalja Kljutscharjowas Tagebuch vom Ende der Welt zu spüren.
Etwas anders sieht der Blick in die Zukunft aus. Übereinstimmend ist die Sorge, dass es keine geben könnte, für die jeweilige Person, aber auch für das gesamte Land. Was genau damit gemeint ist, hängt vom Standpunkt und der Lebenssituation ab; die Künstlerin sieht eine andere Zukunft schwinden als der politisch gut vernetzte und aktive Journalist einer großen Zeitung.
Damit korrespondiert auf eine bemerkenswerte Weise der Verlust der Vergangenheit. Gewissheiten zerstäuben im Sturmwind des Angriffs- und Vernichtungskrieges, letztlich auch die Vergangenheit des so genannten „Großen Vaterländischen Krieges“, dem propagandistisch bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Erinnern an den Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands im Sommer 1941. Selbst das, was unter den Bergen an Lügen durchschimmert, verliert an Wert, wenn man selbst Teil eines verbrecherischen Krieges ist.
Vor allem ein Beitrag aus Belarus hat mir viel Stoff zum Nachdenken geschenkt. Für das Land, das für kurze Zeit mit so vielen Hoffnungen bedacht war, die – wie so unendlich viele zuvor – von der erbarmungslosen russländisch-imperialen Machtmaschine zermalmt wurden, ist Teil des Krieges: Aufmarschgebiet, Stützpunkt für die Luftangriffe auf zivile Ziele, Lieferant von Material an den Aggressor, wenn auch kein aktiver Kriegspartizipant.
Für Belarusen ist das eine immens schwierige Lage. Wer möchte es den Ukrainern verdenken, wenn sie mit dem Finger auf die Einwohner zeigen und Vorwürfe äußern. Wie soll man damit umgehen? Eigentlich hat das belarusische Volk sehr deutlich gezeigt, dass die Führung des Landes nicht Belarus ist, im Gegenteil, die Verantwortung liegt also beim Regime.
Trotzdem machen es sich belarusische Kommentatoren des Krieges nicht so leicht und wälzen alles auf die Herrschenden ab; die Scham gegenüber den Ukrainern ist spürbar, auch das verzweifelte Bemühen, eine halt- und tragbare Haltung zu dem Verhängnis zu finden. Man ahnt: ein vergebliches Unterfangen, Kriege nehmen keinerlei Rücksichten auf Befindlichkeiten, von absolut Niemandem.
Die Staatsmacht hat Boris Romantschenko den Krieg erklärt. Dieser alte Mann hat vier Konzentrationslager, darunter Buchenwald, überlebt. Im März 2022 ist eine russische Rakete in Charkiw eingeschlagen und hat ihn getötet. (Wladimir Metjolkin)
Dekoder (Hrsg.): »Das ist ein Ozean aus Wahnsinn«
Der für mich bewegendste Beitrag stammt von Wladimir Metjolkin, der als Journalist für die Studentenzeitschrift Doxa gearbeitet hat und angeklagt wurde. Anfang April 2022 wurde er verurteilt und hat in seinem Schlusswort bei der Gerichtsverhandlung über den Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine gesprochen.
Metjolkins Mut ist für mich höchst beeindruckend, ebenso die Klarheit, mit der er den russländischen Angriffskrieg charakterisiert und darstellt. Er stellt das in Russland gepflegte Narrativ von der Befreier- und Siegernation im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland gegen jene Opfer in der Ukraine, die Veteranen des Zweiten Weltkrieges und Überlebende des Holocaust waren.
Er schildert klar, wie menschenverachtend die russländische Kriegführung auch gegenüber den eigenen Leuten ist, aber selbstverständlich auch gegen Zivilisten, Frauen, Kinder in der Ukraine. Die Propaganda wird als solche demaskiert, die horrenden Folgen für Russland ebenso klar benannt, wie das, was zu dem dramatischen Zivilisationsbruch führte: Putins Drang nach ewiger Macht und »imperialistisches Denken«. Mit diesem Mann gibt es nichts zu verhandeln.
[Rezensionsexemplar]
Dekoder (Hrsg.): »Das ist ein Ozean aus Wahnsinn«
Verschiedene Übersetzer
edition.fotoTAPETA_Flugschrift 2023
Broschiert 224 Seiten
ISBN: 978-3-949262-31-9