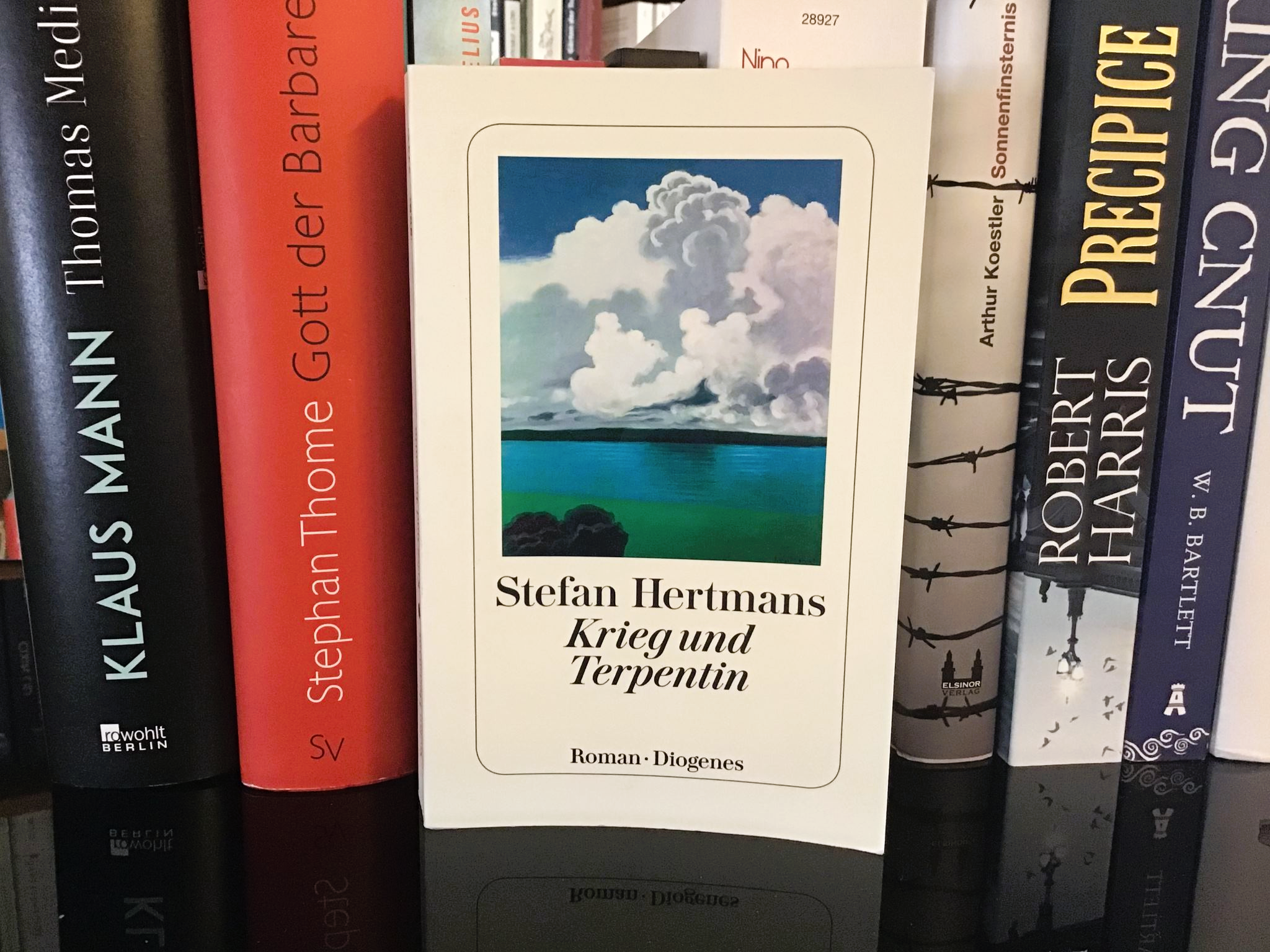Zum Zeitpunkt, da die Handlung des Romans Rath anhebt, war es noch ein Jahr hin, dass der deutsche Wehrmachtsoffizier Wilm Hosenfeld angesichts der unmenschlichen Behandlung von Polen und Juden seine Uniform in Fetzen reißen wollte. Drei Jahre fehlten noch zum »Holocaust mit Kugeln«, der hunderttausende Opfer forderte. Und es blieben noch vier Jahre bis in den Gaskammern Millionen starben.
Der Zivilisationsbruch durch die Kulturnation Deutschland kam nicht aus heiterem Himmel. Wer die Romane Volker Kutschers um den Kriminalkommissar Gereon Rath liest, erlebt hautnah, wie das Gift nationalsozialistischer Ideologie in den Jahren vor und nach 1933 immer tiefer in die Gesellschaft und ihre Institutionen einsickerte, sie durchdrang und schließlich mit millionenfacher bereitwilliger Beihilfe in Krieg und Massenmord führte.
Die Romanreihe endet in jenem Moment, in dem der Zivilisationsbruch für alle Welt sichtbar wurde. Zielstrebig steuert die Handlung von Rath auf den 9. November 1938 zu. Die »Reichspogromnacht« fegte die letzten Zweifel an der gnadenlosen Exekution der antisemitischen Ideologie des NS-Regimes beiseite, es war der Schritt von Ausgrenzung und Ausschreitungen zur systematischen Gewaltanwendung jenes entrechteten Teil der Bevölkerung Deutschlands, der von den Machthabern als »jüdisch« angesehen wurden.
Literatur, die sich auf das Feld der Politik begibt, droht immer von dieser verschlungen zu werden.
Leonardo Padura, Das Meer der Illusionen
Volker Kutscher webt auf brillante Weise dieses historisch-politische Motiv in die Romanhandlung ein. Das ist ein Glanzpunkt von Rath, denn Kutscher gelingt das Kunststück, politisch zu schreiben, ohne den Roman von der Politik verschlingen zu lassen. Seine Figuren erleben, was es heißt, in dieser Zeit existieren zu müssen. Überleben ist keine Selbstverständlichkeit. Die Szenen, die den 9. November 1938 erzählen, sind von mitreißender Dichte. Die Atmosphäre erfasst den Leser und lässt ihn nicht wieder los.
Die Erschütterung des Pogroms, das zügellose Treiben der Nazis, das Verhalten der nicht-jüdischen Nachbarn, die völlige Recht- und Schutzlosigkeit der Opfer erleben gleich mehrere Personen am eigenen Leibe, die während der Handlung mit Gereon, Charlotte und anderen bekannten Personen zu tun hatten. Was über die als jüdisch geltende Bevölkerung hereinbrach, war bis dahin eher aus dem Osten Europas bekannt; die Illusion der jüdischen Integration in Deutschland seit Friedrich dem Großen verflüchtigte sich endgültig.
Der Herbst 1938 war auch in anderer Hinsicht disruptiv, was Kutscher zum Vorteil der dynamischen Romanhandlung nebenbei abhandelt. Aus München dringt während der Handlung immer wieder der ferne Donner eines heraufziehenden Krieges. Das Unheil kann gerade noch abgewendet werden, die in Verruf geratene Appeasement-Politik führte zu einer Übereinkunft auf dem Rücken der Tschechoslowakei. Damit liefen Putsch-Pläne des deutschen Militärs ins Leere, ein noch größeres Unheil, das in einem Halbsatz durchschimmert. Mehr braucht es auch nicht.
›Hilft ja alles nix. Am Ende entscheidet Hitler darüber, ob er Kriech will oder nit.‹
Volker Kutscher: Rath
Wie aber beendet man eine Buchreihe an einem nachtschwarzen Zeitpunkt? Ein Happy End verbietet sich. Volker Kutscher hat in einem Interview mit der FAZ einen interessanten Hinweis auf seine Überlegungen gegeben. Ein mögliches Final-Szenario wäre gewesen, dass die Familie Rath (Gereon, Charlotte, Friedrich) in Prag ist, wohin sie zwischenzeitlich tatsächlich flüchten wollte. Man sitzt um einen Tisch und draußen marschiert im März 1939 die Wehrmacht ein, hinter den Truppen folgen SS und Gestapo.
Kutscher hat sich für ein anderes, spektakuläres Ende entschieden, was mir außerordentlich gut gefallen hat. Der Leser schaut einigen lose im Wind der Geschichte baumelnden Erzählfäden hinterher, im Grunde genommen weiß man bei keiner der überlebenden Personen, wie es mit ihnen weitergehen wird. Das ist ein angemessener Umgang mit einem historischen Stoff, denn Geschichte ist immer offen. Nur rückwärtsgewandte Propheten behaupten anderes.
Die Wirkung des Endes wird verstärkt durch die dramatische Zuspitzung der Handlungsstränge. Das letzte Drittel des Romans liest man wie im Rausch, ein Pageturner, befeuert von voranjagender Spannung. Die vielfältigen Konflikte der vorangegangenen Bücher steuern auf eine »Lösung« zu, vor allem die Verwicklungen um Rath-Tornow-Gräf und Charly-Rademann-Fritze finden ihr überraschendes Ende.
Ihr könnt nicht da weitermachen, wo ihr aufgehört habt. All diese Dinge sind passiert. Die haben euch verändert. Die Zeiten haben sich verändert. Und eure Ehe, wenn man das noch so nennen kann, sowieso.
Volker Kutscher: Rath
Rath wie die gesamte Buchreihe lassen viele (Neben-)Figuren nicht unberührt von dem, was ihnen widerfährt. Wenn etwa ein SA-Mann von einem Bürger zu Tode geprügelt wird, zeigt das eben auch, wie sehr die zügellose Gewalt des Regimes und seiner Formationen in die Gesellschaft zurückwirkt. Auch dort brechen die Barrieren. Die Tötung ist keine reine Rache-Szene á la Italo-Western, sondern ein Sinnbild der fortschreitenden Enthemmung, die von den Nazis auf gewöhnliche Bürger ausstrahlt.
Auch die Hauptfigur ist davon betroffen, denn die Beziehung Gereons mit Charlotte ist erodiert und brüchig. Die Flucht nach Amerika nach dem Scheintod hat die Distanz vergrößert, der Graben bleibt auch in Rath lange offen. Allein die Umstände lassen nur kurze Stelldicheins in einem Hotel in Hannover zu. Gereon ist im Rheinland untergetaucht, Charlotte wurstelt sich in Berlin als Detektivin durch, ehe die Umstände rasante Veränderungen herbeiführen.
Wie schon in Transatlantik trägt Charly die Hauptlast der Handlung, Gereon ist abgetaucht. Kutscher deutet an einer Stelle ein geradezu klassisches Handlungsmotiv an, indem er Charlotte in dramatische Schwierigkeiten geraten und Gereon zu ihrer Rettung aufbrechen lässt. Die Rettungsmission löst sich jedoch auf überraschende Weise auf und Gereons Rolle als Retter läuft ins Leere. Mich hat bei der Lektüre die Frage beschäftigt, ob eine Buchreihe, die in acht von zehn Teilen auf eine Figur zugeschnitten ist, in den letzten beiden Bänden einen so weitreichenden Schwenk weg von der Hauptfigur vollziehen sollte.
Gereon Rath schwindet bereits in Transatlantik als handelnde Figur, mehr noch in Rath. Seine Lebensweise, das unpolitische Durchwursteln mit Abstechern in die Grauzone der Legalität, war schon lange an einer Grenze angekommen, dahinter blieb nur noch eine Flucht in die USA. Das Schwinden der Person in der Handlung spiegelt die Ausweglosigkeit und mangelnde Lernfähigkeit Gereon Raths wider und ist absolut vertretbar. Die Frage sei gestattet, ob unter diesen Umständen noch die letzten beiden Bände in der Form sinnvoll sind.
Die Frage stellt sich noch aus einem anderen Grund.
Schwerer wiegt nämlich, dass die Gegenfigur zu Gereon nicht recht glaubwürdig wirkt. Charlotte Rath war bereits in den vorangegangenen Bänden einerseits ein wenig zu tough, gleichzeitig in ihren (oft selbstschädigenden) Handlungsmustern gefangen. Das setzt sich verschärft in Rath fort. Insbesondere die hochdramatischen Ereignisse nach dem Verrat eines alten »Freundes«, den Kutscher grandios als Musterbeispiel des angepassten Karrieristen gestaltet, hinterlassen scheinbar nur zarte äußerliche Spuren. Sie tritt danach wie davor auf, was schwer zu glauben ist.
Von dieser leisen Kritik unabhängig ist Rath ein furioser und angemessen furchtbarer Abschluss einer großartigen Buchreihe. Die Ermittlungen um den »Kriminalfall« bilden wieder einen leitenden roten Faden, die Erzählung ist abermals makellos in die Zeitläufte eingewoben. Die handelnden Figuren prallen aufeinander, wirbeln umeinander, ringen miteinander, verkrallen sich ineinander und führen einen irren Tanz auf, einen Totentanz am Abgrund.
Weitere Romane der Buchreihe:
Volker Kutscher: Die Akte Vaterland
Volker Kutscher: Märzgefallene
Volker Kutscher: Lunapark
Volker Kutscher: Marlow
Volker Kutscher: Olympia
Volker Kutscher: Transatlantik
[Rezensionsexemplar]
Volker Kutscher: Rath
Piper 2024
Gebunden 624 Seiten
ISBN 978-3-492-07410-0