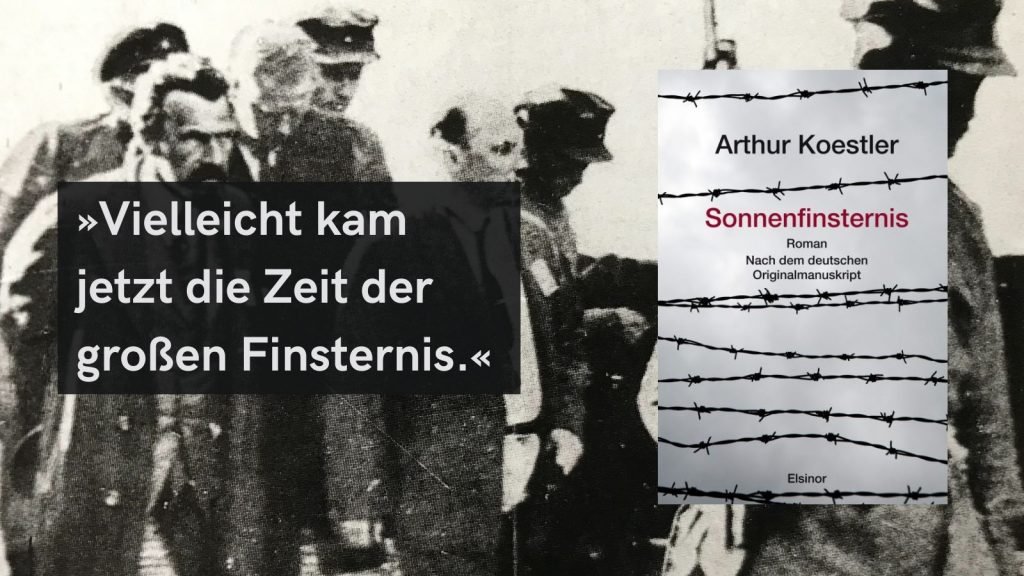
›Man wird dich also erschießen‹, dachte Rubaschow.
Arthur Koestler: Sonnenfinsternis
Schon am Anfang ist das Ende klar. Nicolas Salmanowitsch Rubaschow ist dem Tode geweiht. Er weiß es und der Leser weiß es auch. Wer in der stalinistischen Sowjetunion während der Zeit der Säuberungen, also der massenhaften Ermordung von Parteimitgliedern, verhaftet wurde, war eine lebende Leiche. Rubaschow, ein Parteimann im Range eines Volkskommissars, Revolutionär und Bürgerkriegsoffizier der Roten Armee, durfte erst recht nicht auf Milde hoffen, im Gegenteil: Leuten wie ihm galt Stalins mörderischer Furor Mitte der 1930er Jahre.
Auch das ist Rubaschow bewusst, als »die Zellentür hinter ihm ins Schloss« kracht. Wie in seinem Roman Der Sklavenkrieg beginnt Arthur Koestler mit einem starken Bild. Das könnte auch am Ende einer Erzählung stehen, die das Schicksal einer Person während der Terrorjahre schildert, bevor sie verhaftet wird. Die bleierne Angst, die vielen Verhaftungen im Umfeld, die verzweifelten Versuche, das Schicksal abzuwenden, also dramatische Motive, die in Romanen wie Der Lärm der Zeit von Julian Barnes verarbeitet werden.
Koestler setzt in dem Moment an, in dem anderswo die Handlungs-Spannung abfällt. Es ist passiert. Das Kind liegt im Brunnen und ertrinkt. Um die verlockende Spannung vor diesem Augenblick geht es dem Autor nicht, er legt den Fokus auf den Zeitraum zwischen Verhaftung und Hinrichtung, auf die Verhöre und den aberwitzigen Irrsinn, zu dem sich die Revolution unter dem Regime Stalins gewandelt hat. Koestler fasst das ist ein treffendes Bild.
Die Partei hat Gicht und Krampfadern an allen Gliedern.
Arthur Koestler: Sonnenfinsternis
Koestler verfasste Sonnenfinsternis 1939/40, zu diesem Zeitpunkt hatte Stalins Russland viele Millionen Menschen auf dem Gewissen; jene, die wie Rubaschow Teil des Systems waren, stellten nur ein verschwindend kleinen Teil. Der zitierte Satz meint also nur einen Bruchteil der Gemordeten, nach Stalins Tod wurden auch nur diese rehabilitiert. Die anderen Opfer, von Bürgerkrieg über Holodomor und den Verschleppten aus den eroberten Gebieten bis hin zu den Insassen der Arbeits- und Vernichtungslager, spielen keine Rolle.
Das kann man Koestler schwerlich vorwerfen. Die Propaganda der Sowjetunion hat es geschickt verstanden, die eigenen Verbrechen in den Schatten der Untaten zu verbergen, die durch die Nationalsozialisten begangen wurden. Erst Historiker wie Timothy Snyder (Bloodlands) haben mehr als fünfzig Jahre nach Kriegsende für ein ausgewogenes Bild gesorgt und Millionen gemeuchelte Menschen aus dem Vergessen geholt. Sie rückten auch die systematische Massenfolter ins Licht, die eingesetzt wurde, um groteske Geständnisse aus den Inhaftierten zu pressen.
Koestler hat sich vom Sowjetkommunismus abgewandt, als andere Intellektuelle wie Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger oder Anna Seghers noch eisenhart die Parteilinie vertraten. Wie schwer es sein kann, vom stalinistischen »Glauben« abzufallen, zeigt etwa Jorge Sempruns Was für ein schöner Sonntag! oder auch Leonardo Paduras Der Mann, der Hunde liebte. Der kubanische Autor zeigt die Abgründe von Stalins Reich auf, zeichnet gleichzeitig ein arg positives Bild von Leo Trotzki, an dessen Händen viel Blut klebte.
Koestler besaß den Mut und die Kraft, sich sehr früh loszusagen, er war ein Mann mit bemerkenswerter Konsequenz. Er kehrte nicht nur dem stalinistischen Kommunismus den Rücken, sondern schrieb nach seiner Flucht aus Frankreich im Jahr 1940 nur noch auf Englisch, brach also auch mit NS-Deutschland in einer Weise, die für viele andere Exilanten nicht infrage kam. Kurioserweise gilt er aus deshalb vielen als angelsächsischer Schriftsteller, obwohl er zentrale Werke wie Sonnenfinsternis und Der Sklavenkrieg auf Deutsch verfasste.
Die Partei kann sich nicht irren, sagte Rubaschow.
Arthur Koestler: Sonnenfinsternis
Der Protagonist Rubaschow ist von seiner Verhaftung nicht überrascht. Ohnehin ist ihm das Gefängnis vertraut, er saß im Laufe eines Auslandseinsatzes in nationalsozialistischer Haft, wurde gefoltert und schwieg. Trotz seiner vielumjubelten Rückkehr als Held geriet er schnell mehrfach in die gnadenlose Mühle des stalinistischen Systems, ihm wurde vorgeworfen, ein Abweichler zu sein. Um sich zu retten, wählte er eine reichlich bolschewistische Lösung und lieferte seine Sekretärin und Geliebte an Messer.
Tatsächlich zeichnet Koestler die Hauptfigur Rubaschow mit Widersprüchen. Er ist eine Art Dissident, ihm ist das Land mit seinem Führerkult zutiefst zuwider, auch wenn er sich weder offen auflehnt noch unsäglich grausame und amoralische Aufträge verweigert. So lieferte er deutsche Untergrund-Kommunisten an die Gestapo aus, weil sich die Genossen weigertnn, die völlig irreale Propaganda aus Moskau zu verbreiten. Die Partei und Stalin hätten recht, sie könnten nicht irren, dieser »Wahrheit« müsse sich auch die Realität beugen. Rubaschow ist kein Sympathieträger, sondern gefallener Gefolgsmann einer mörderischen Diktatur.
Spektakulär ist, dass Koestler ganz früh im Buch Parallelen zwischen Kommunismus stalinscher Prägung und dem Nationalsozialismus zieht. Bevor Rubaschow durch zwei Beamte des Volkskommissariats des Inneren verhaftet wird, träumt er seine Verhaftung durch die SS. Diese Montage ist kein Zufall, auch nicht das Motiv des Schlages mit einem Revolverknauf ins Gesicht – einmal im Traum durch die Nazi-Schergen, später in der Realität durch Stalins Häscher. Am Ende fragt sich Rubaschow, wer ihn eigentlich tötet, welches »Symbol« der Exekutor an seiner Uniform trägt. Nazis und Kommunisiten sind austauschbar. Starker Tobak im Jahr 1940.
Die Parallelen beider Gewaltregime waren lange tabu, eine plumpe Gleichsetzung verbietet sich selbstverständlich. 1940 galt noch der Pakt zwischen Hitler und Stalin, da mag es Koestler leichter gefallen sein, diese zu erkennen und benennen. Nach dem Beginn des Ostfeldzuges der Wehrmacht galt die Sowjetunion als ungeliebter, aber wichtiger Verbündeter im Kampf gegen das Hitlerregime. Nach dem Krieg und Stalins Tod griff Wassilij Grossmann in seinem Epos Leben und Schicksal das Motiv der Parallelen zwischen Stalinismus und Nationalsozialismus in Bezug auf die Lagerwelten in beiden Diktaturen auf, prompt wurde der Roman in der Sowjetunion verboten.
›Gekreuzigt wird man immer im Namen des eigenen Glaubens.‹
Arthur Koestler: Sonnenfinsternis
Zwei Verhörzyklen bilden den Hauptteil des Romans Sonnenfinsternis. Arthur Koestler hat zwei grundverschiedene Typen von Verhöroffizieren geschaffen. Iwanoff, der auf Kommunikation setzt, und Gletkin, bei dem Folter (Schlafentzug) und psychischer Druck zum Erfolg führen sollen. Das Ende dieser Prozedur wird durch Rubaschow schon am Anfang vorweggenommen, die Art und Weise, wie die Geständnisse zustande kommen, nehmen sich gegenüber der historischen Realität eher harmlos aus; dennoch ist es erschütternd und zutiefst beunruhigend als Leser mitzuerleben, wie in einem totalen Unrechtsstaat jemand gebrochen wird.
George Orwell hatte in seinem berühmten Roman 1984 auf eine Schilderung der brutalen Methoden verzichtet, nur das Ergebnis vorgeführt. Koestlers Sonnenfinsternis verzichtet bewusst oder aus Unkenntnis auf eine explizite Folter-Darstellung, die angedeutete Gewalt und das kalte, zynische Kalkül dahinter reichen jedoch völlig aus. Als weitere Ebene berührt der Roman die Frage der Schuld. Dank der erzwungenen, irrealen Geständnisse ist Rubaschow (wie viele seiner Mitstreiter) unschuldig, allerdings hat er durch seine Tätigkeit für die Bolschewiki Schuld auf sich geladen.
Ein ausführliches Vor- und Nachwort informieren über die Entstehungsgeschichte von Sonnenfinsternis, den internationalen Erfolg des Romans und die zum Teil heftige und aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen kommende Kritik. Besonders interessant ist der Umstand, dass man endlich die originale deutsche Fassung des Romans lesen kann – eine den Umständen geschuldete und durch glückliche Zufälle erst Jahrzehnte nach Kriegsende bereinigte Kuriosität.
Arthur Koestler: Sonnenfinsternis
Nach dem deutschen Originalmanuskript
Mit einem Vorwort von Michael Scammmell
und einem Nachwort von Mattias Weßel
Elsinor 2017
Gebunden 256 Seiten
ISBN: 978-3-942788-40-3
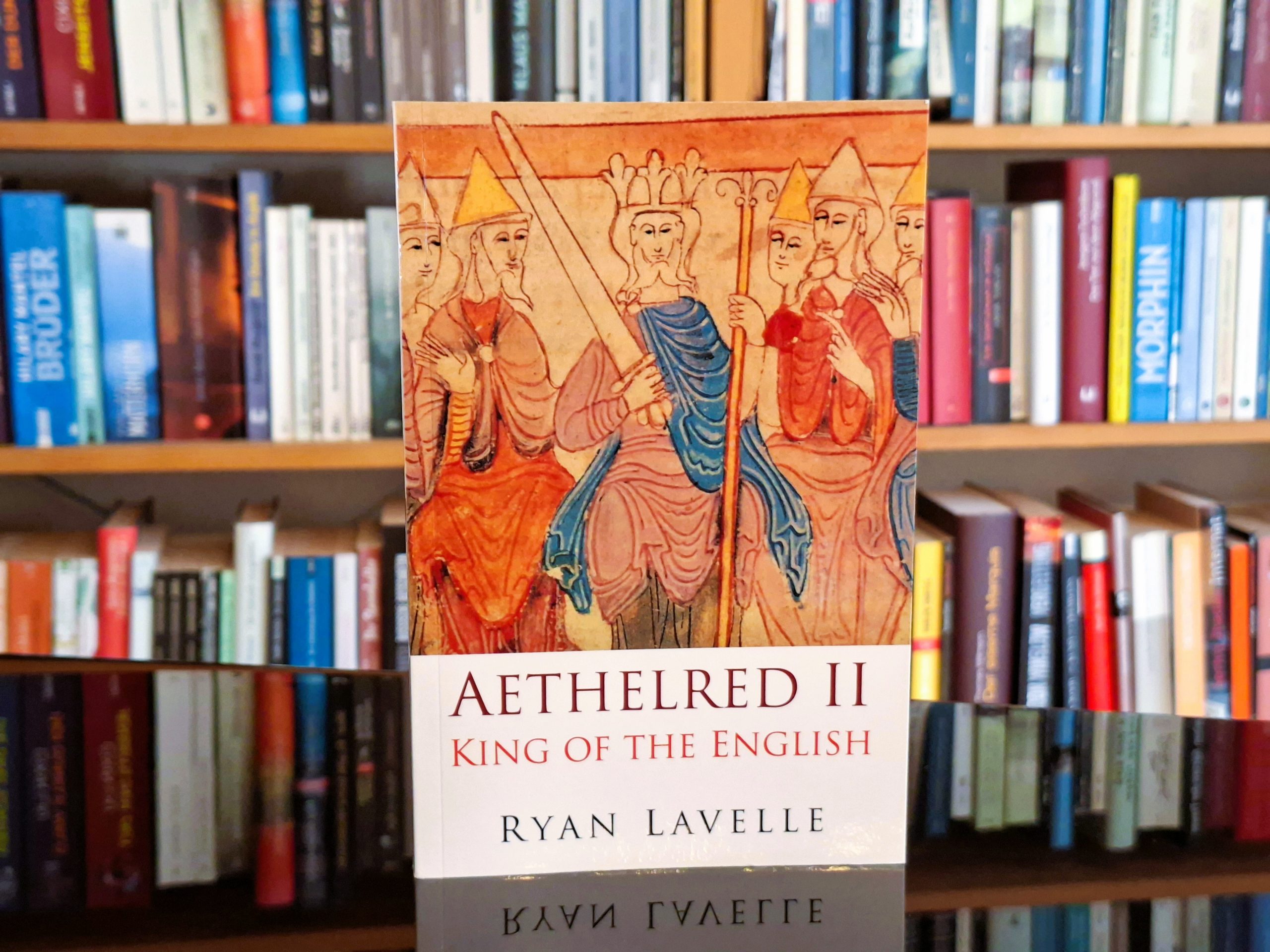
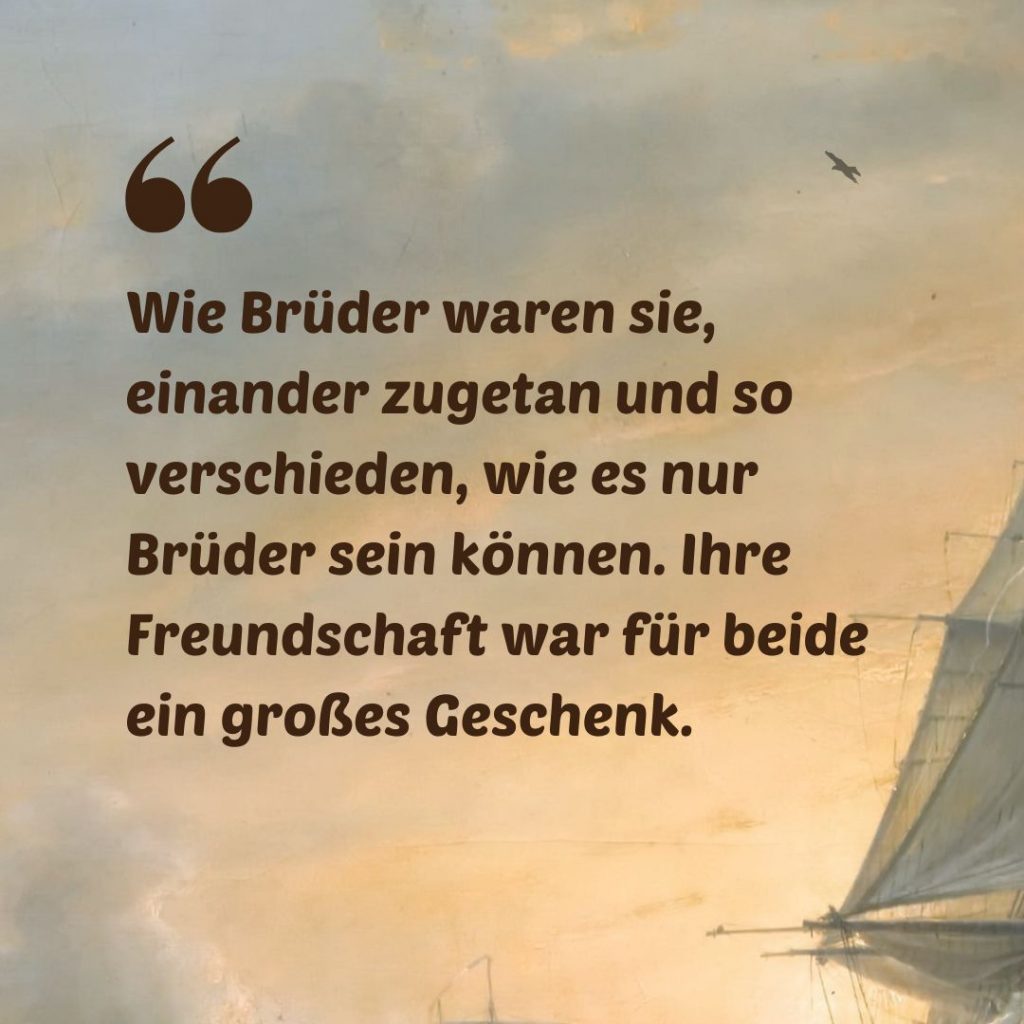
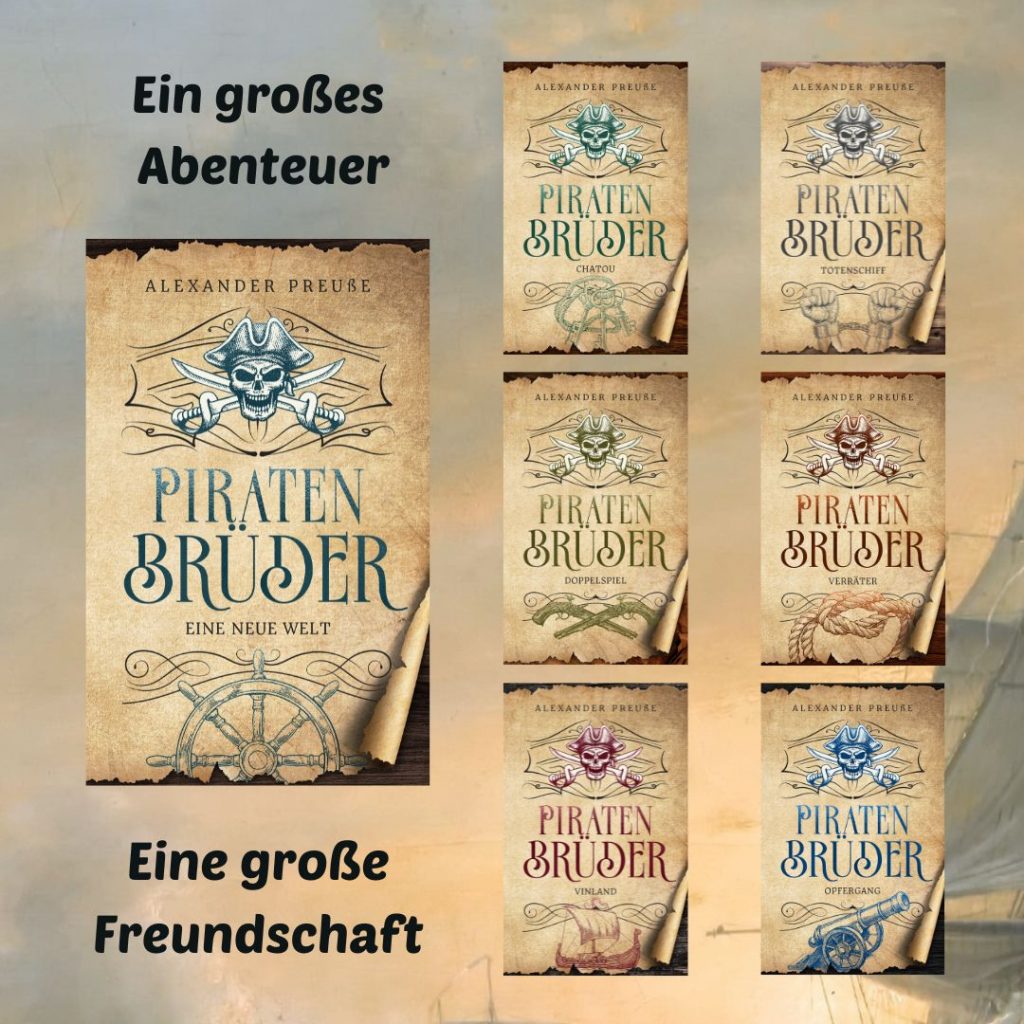


Schreibe einen Kommentar