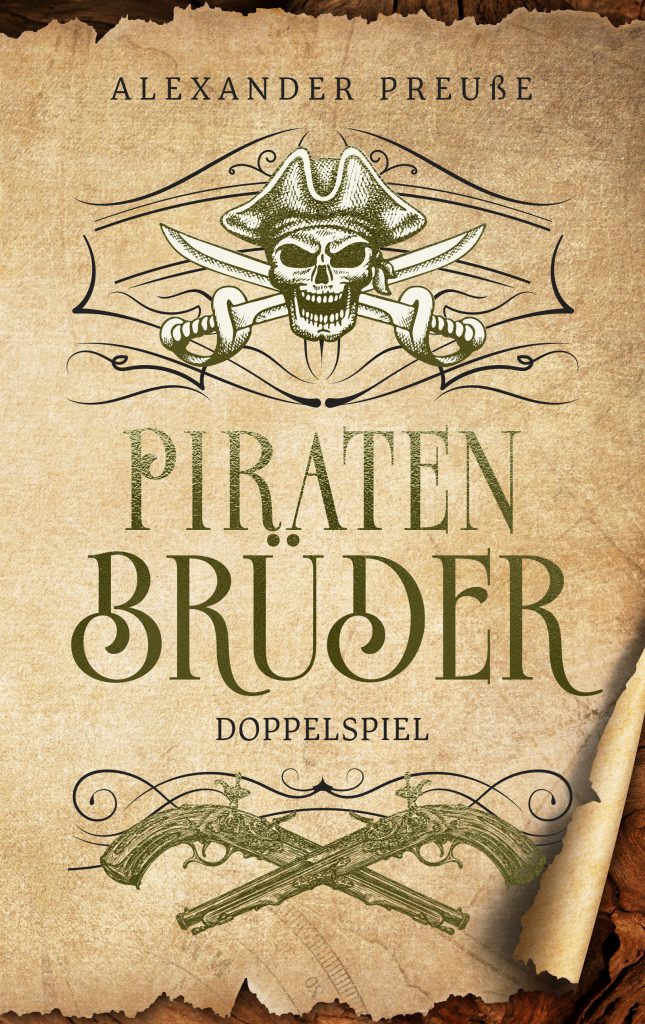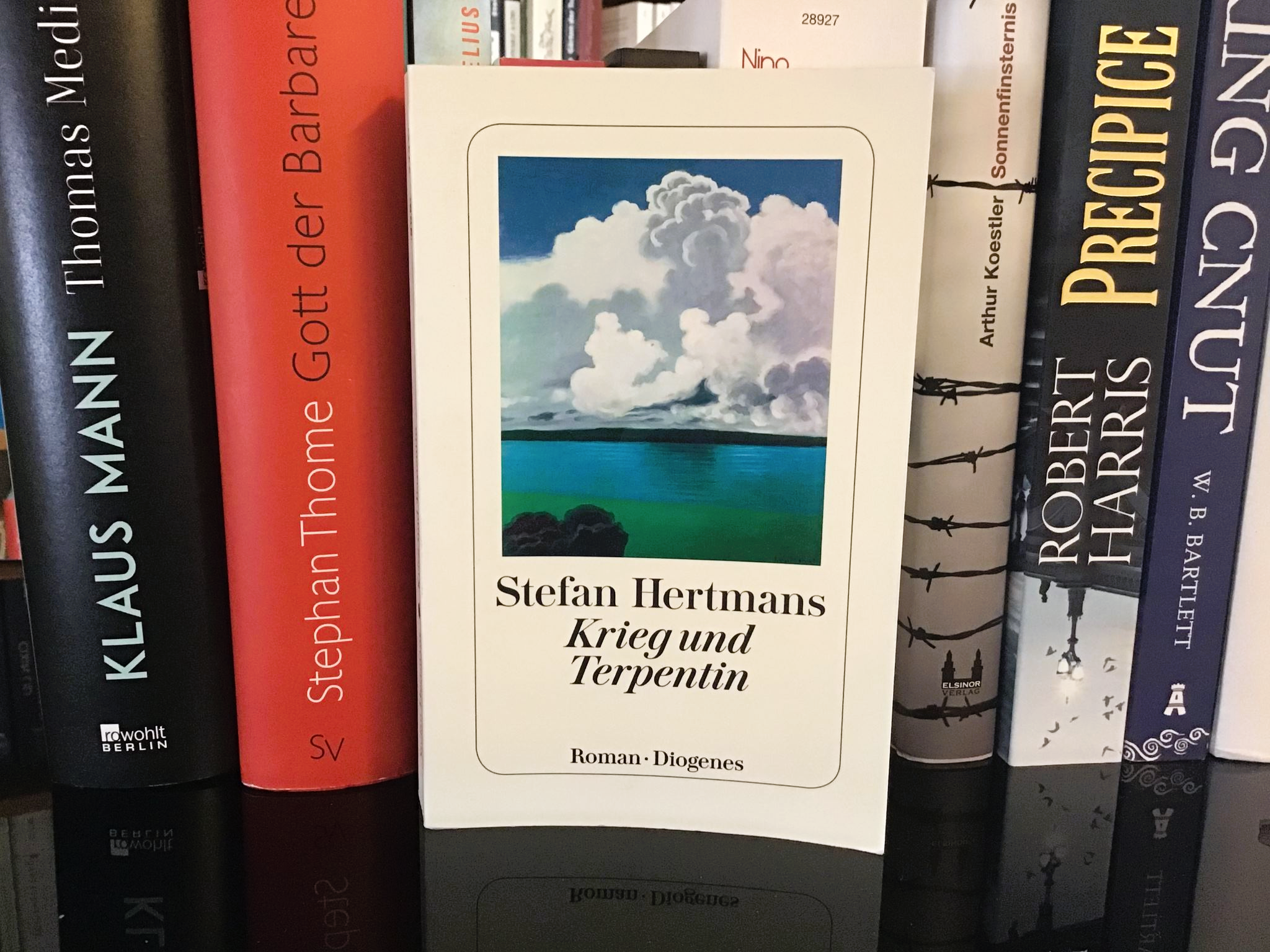Unweit von Mitkau, einer kleinen Stadt in Ostpreußen, lag das Gut Georgenhof mit seinen alten Eichen jetzt im Winter wie eine schwarze Hallig in einem weißen Meer.
Walter Kempowski: Alles umsonst
Wer das ostpreußische Städtchen Mitkau auf einer Karte sucht, wird sie nicht finden. Walter Kempowski lässt seinen Roman Alles umsonst zum großen Teil in der Nähe einer erdachten Ortschaft spielen. Realitätsfern ist auch das in die Jahre gekommene Gut Georgenhof, in dem die Personen in Unwirklichkeiten versponnen ihre Tage verleben. Ihre letzten, denn die Handlung führt in den blutigen Januar 1945, in dem Millionen Soldaten und Zivilisten ihr Leben ließen.
Das Gut bewohnen Katharina von Globig, eine zugezogene, verträumte Schönheit, die Gutsbetrieb, Mitkau und der Region fremd geblieben ist. Sie ist verheiratet mit Eberhard von Globig, der wilhelminischem Beamtenadel entstammt und in der Wehrmacht als Offizier Dienst tut: Frankreich, Ukraine, Italien. Etappe statt Front, was sich im Raubkrieg mit wiederholt eintreffenden Paketen mit kulinarischen Köstlichkeiten niederschlägt. Trittbrett fahrende Kriegsgewinnler.
Zur Familie gehört noch das »Tantchen«, Helene Harnisch, eine Anverwandte aus Schlesien, die nach einem Bankrott im Georgenhof Unterschlupf gefunden hat und dort – gegen ein Taschengeld – defacto den Laden in Schuss hält, weil sie im Gegensatz zu Katharina nicht der Wirklichkeit entrückt ist. Sohn Peter ist ganz in seine Kindheit versponnen, seine Schwester Ida verstorben. Peter ist – wie alle anderen im Gut lebenden Menschen – isoliert, kränkelnd gehört er nicht der Hitlerjugend an; von Linientreue kann bei den von Globigs und ihrem Haushalt keine Rede sein.
Kriegsbedingt arbeiten Wladimir, ein Pole, Anna und Vera, zwei von Eberhard selbst angeworbene Ukrainerinnen, auf dem Hof. In einem nahegelegenen, ehemaligen Gasthof hausen zur Zwangsarbeit verpflichtete Europäer verschiedener Herkunft, Kriegsgefangene und Zivilisten. Regelmäßiger Gast im Georgenhof ist Lehrer Dr. Wagner, der sich um Peter kümmert, so lange die Schule für Flüchtlinge zweckentfremdet und geschlossen ist.
Auf der Straße fuhr ein einzelnes Auto in Richtung Mitkau rasch vorüber, dann folgten andere und schließlich Lastwagen, auch Panzer, einer hinter dem anderen, die Glasperlen der Lampe klirrten. Dann trat Stille ein.
Walter Kempowski: Alles umsonst
Die Erzählung setzt am 8. Januar 1945 ein, vier Tage vor Beginn der Großoffensive der Roten Armee, die innerhalb von drei Wochen von der Weichsel bis an die Oder vorrücken sollte. Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm, die niemandem recht geheuer ist, und trotzdem außer vereinzelten besorgniserregenden Gedanken keinerlei Vorbereitungen auf eine Flucht hervorruft. Dabei haben die von Bewohner des Guts schon eine Reisebescheinigung und könnten jederzeit aufbrechen, wo andere endlos auf die Genehmigung warten mussten, die – wenn überhaupt – kam, als es zu spät war.
Besucher kommen ins Haus, ein Ökonom, eine Geigerin, ein Wehrmachtssoldat, Flüchtlinge aus dem Baltikum und dem Osten Ostpreußens; sie erzählen, oft Lügen, machen Andeutungen über die im Osten begangenen Verbrechen, Andeutungen die im Hause von Globig niemand versteht. Die Gäste nehmen Essen und Gesellschaft gern an, sie übernachten dort, stehlen und machen sich wieder von dannen.
Die Leute auf dem Gut leben unter einem Damoklesschwert, das sie zur Kenntnis nehmen könnten; sie tun es nicht, auch wenn sie mit der Nase darauf gestoßen werden. Der Kontrast zwischen der lebensbedrohlichen Lage und der hauseigenen Unwirklichkeit lässt sich weder mit Dummheit, Propaganda noch Angst vor dem NS-Terror erklären, die Ignoranz ist etwas, das weit über die konkrete Situation hinausreicht.
Menschliches Verdrängen im Angesicht einer überwältigenden Katastrophe ist wahrlich ein grundlegendes Phänomen. Ausnahmen bestätigen die Regel, Hannah Ahrendt etwa, die 1940 beim Herannahen der Wehrmacht Chaos und Anarchie unter den französischen Behörden nutzte, um sich von ihrem Internierungslager zu entfernen. Viele andere blieben, warteten ab und starben.
›Sofort die Sachen packen und auf und davon! Ja? Wegfahren, alles stehen und liegen lassen … Gleich morgen früh! … Die Russen kommen!‹
Walter Kempowski: Alles umsonst
Der Leser des Romans weiß, was kommen, was über die Menschen hereinbrechen wird. Immer wieder wird daran erinnert, im Nebensatz, wie willkürlich eingestreut. Ein Fliegeralarm. Zur Front rollende Panzer. Eilig zurückgenommene Front-Lazarette. Gerüchte. Nebensächlichkeiten, beunruhigend, aber auch nur am Rande des vorwärts wälzenden Erzählstroms, den Erinnerungen, Gedanken und Beschäftigungen der Figuren.
Von einer Handlung kann man eigentlich nicht sprechen, eher von Nicht-Handeln. Für einen Leser wie mich ist diese Form hintergründiger Spannung kaum erträglich. Immer wieder möchte man den Personen zurufen, sie aufrütteln, aus ihrem Dornröschenschlaf der unbedarften Weltabgewandtheit wecken. Ein sinnloses Unterfangen, wie man weiß und Autor Kempowski perfide vorführt: Offene Warnungen führen zu groteskem Verhalten.
Erst einmal abwarten; nichts werde so heiß gegessen …; jemand werde schon sagen, was zu tun sei …; Ob man die Vorhänge waschen sollte, alles gründlich saubermachen, bevor man geht? So in etwa sind die grotesk anmutenden Gedankengänge, auch nach der zweiten, dritten Warnung und Ermunterung, schnellstmöglich das Weite zu suchen, sich in Sicherheit zu bringen. Für den Leser frappierend, denn er ahnt schon – nein, er weiß, dass kein gutes Ende naht. Der Titel des Romans, Alles umsonst, sollte unbedingt ernstgenommen werden.
Und der Mann in seinem Versteck dachte an die dunklen Tage, die vor ihm lagen. es war ja eigentlich ganz ausgeschlossen, daß er es schaffen würde.
Walter Kempowski: Alles umsonst
Auf kunstvolle Weise hat Kempowski das Schicksal seiner Figuren mit dem anderer verwoben. Da wären die Ukrainerinnen, Wladimir und die vielen fremden Arbeiter, die Gegenstand von vielen versteckten, subtilen und ganz offenen rassistischen Äußerungen sind, hinter denen sich das Grauen der völkischen Ideologie und des Vernichtungskrieges wie ein gewaltiger Schatten erhebt. Andeutungen reichen, um den Abgrund des Zivilisationsbruchs zu zeigen.
Doch wird ausgerechnet Katharina, die Weltfremde, vom Pastor Mitkaus um eine Gefälligkeit gebeten: Sie sollte für eine Nacht einen vor dem Regime Fliehenden aufnehmen. Als sie den warnenden Anruf ihres Ehemannes entgegennimmt, befindet sich dieser Mann gerade in ihrer Obhut. Beide Schicksalslinien kreuzen sich in dieser ebenso grotesken wie dramatischen Situation, das Leben ist aus mehreren Richtungen bedroht, gerade im Januar 1945, Gestapo, SS und Feldpolizei kennen keine Gnade.
Die Tragödie nimmt ihren Verlauf. Auch als an der Front tausende von Geschützen die Erde im Umkreis von vielen Kilometern zum Beben bringen, können sich die Bewohner des Georgenhofs nicht aufraffen. Die »Flucht« beginnt zur Unzeit, als die rasch vordringenden Sowjets den Weg ins Reich nach Westen bereits abgeschnitten haben. Nur das zugefrorene Haff und der Abtransport über See bieten noch seidenfadene Hoffnung.
Am Straßenrand lagen Tote, manche saßen erstarrt an einem Chausseebaum; Greise, die nicht mehr weitergekonnt hatten, und kleine Kinder.
Walter Kempowski: Alles umsonst
Kempowski schildert die ungeheuerlichen Umstände dieser überstürzten Flucht, das massenhafte Sterben mit unpathetischen, oft lakonischen Worten. Die ungezählten Toten sind Nebensächlichkeiten am Wegesrand, wie ein Echo der vorher nebensächlichen Frontgeräusche. Manche sind erfroren oder an Erschöpfung gestorben, andere wurden erhängt, weil sie angeblich Deserteure, Plünderer, Feiglinge wären.
Gelegentlich blitzt das Motiv der aus Russland durch Ostpreußen zurückflutenden Trümmer von Napoleons Grande Armée im Jahr 1812 auf. 1945 nimmt der Untergang apokalyptische Dimensionen an, eine Götterdämmerung ohne jedes schwülstige Pathos, wie ihn Nationalsozialisten jahrelang heraufbeschworen hatten. Der Tod kommt so gnadenlos und unspektakulär, im Halbsatz, im Nebensatz sterben Kempowskis Figuren.
Von der »Volksgemeinschaft«, einem weiteren wirklichkeitsfernen Propagandastück, ist nichts zu merken. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das gilt auch für »Oberwart« Drygalski, einen stramm linientreuen Nachbarn der von Globigs, der schneidig seine Anweisungen mit einem »zoffort!« würzt. Er lässt seine Frau zurück und macht sich vor der herannahenden Front zurück. Eine wunderbare Figur, die den Leser vom ersten Augenblick an abstößt und über viele Kapitel enerviert. Ganz am Ende des Romans macht ausgerechnet Drygalski eine spontane, völlig unvermutete Tat – und der Leser taumelt schweratmend aus der Handlung.
Der Roman ist das erste Buch aus meinem Lesevorhaben Wiedergelesen – 4für2025
Walter Kempowski: Alles umsonst
btb Verlag 2006
Taschenbuch 384 Seiten
ISBN: 978-3-442-73736-7