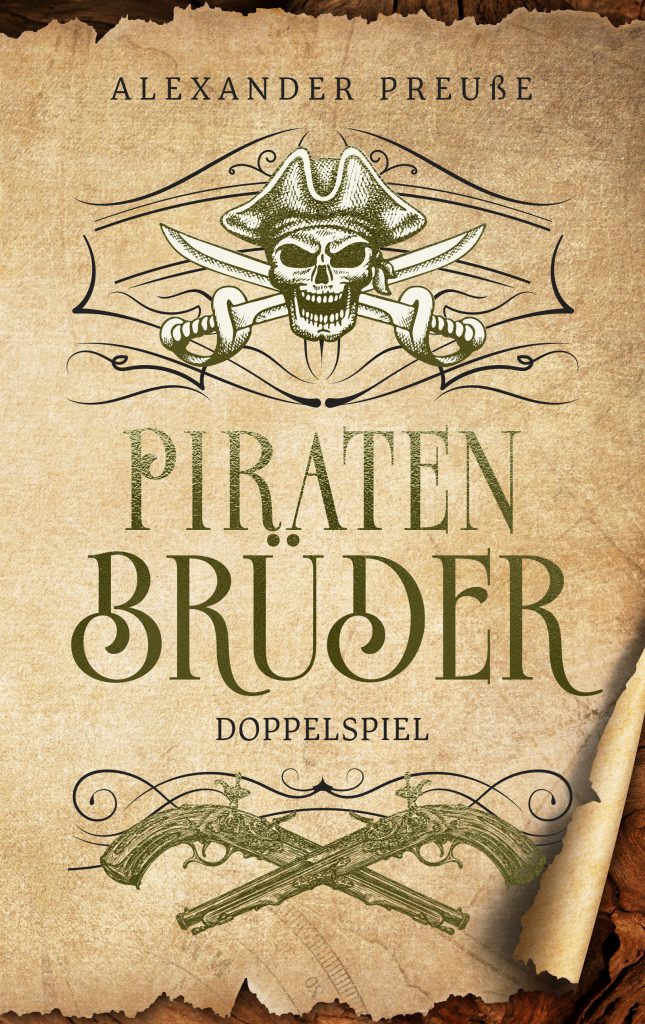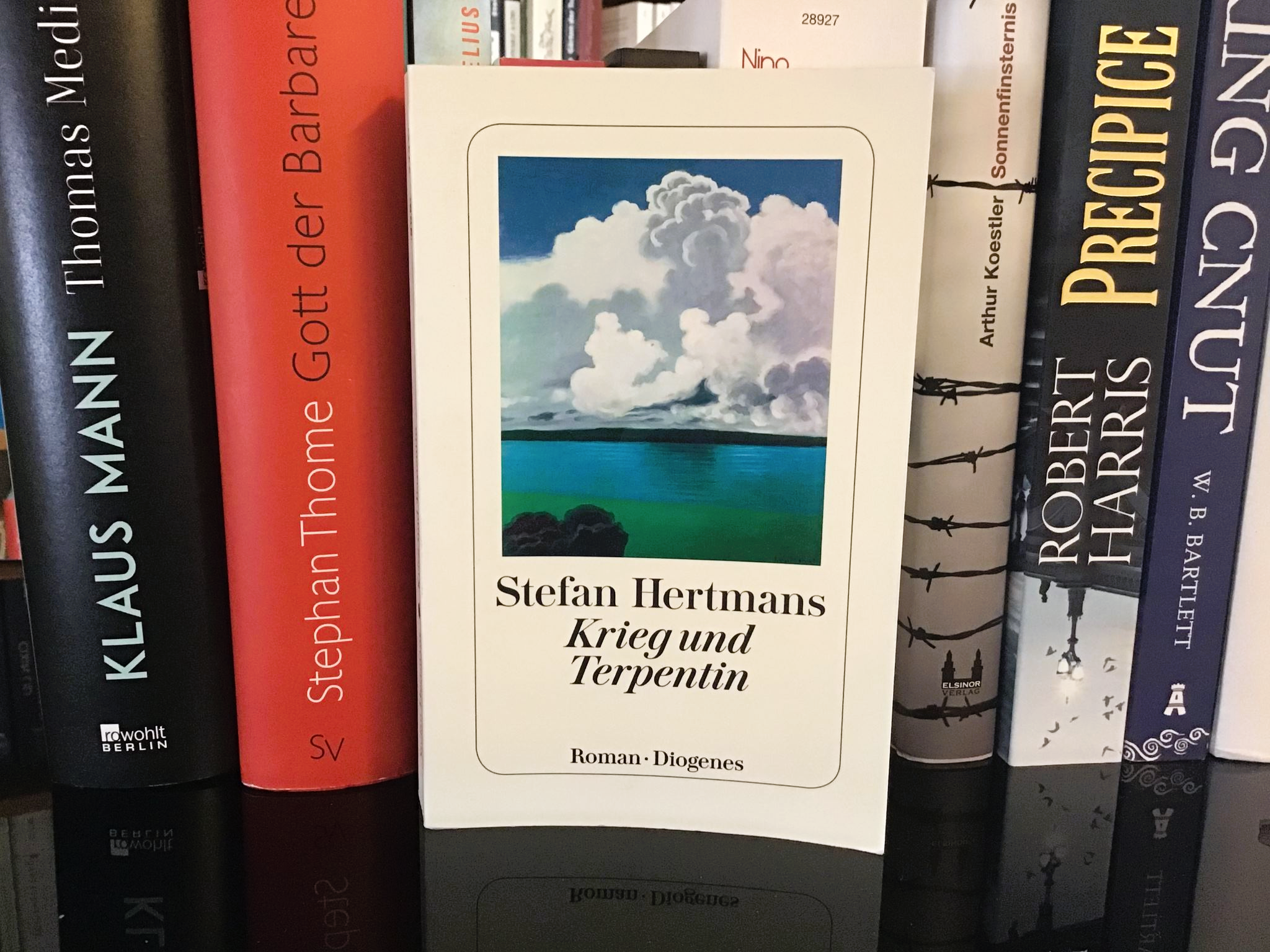In dem Roman Olympia von Volker Kutscher geht es zu wie in einem Spukschloss, so viele Geister der Vergangenheit treiben ihr Unwesen. Die Geister der Gegenwart, die Rath in einem schaurigen Reigen umtanzen, passen eher zu einem finsteren Horror-Schloss, Folterkeller inklusive. Sie tragen schwarze Uniformen, unterstehen Heinrich Himmler, dem Chef von Polizei und SS im »Dritten Reich«, tanzen nach der Pfeife Reinhold Heydrichs, des Herren über Unrecht und Ordnung.
Am Ende des Vorgängerromans Marlow saß Oberkommissar Gereon Rath in einer Falle, die ihm ein Geist der Vergangenheit namens Sebastian Tornow gestellt hatte. Der ehemalige Polizist, einst von Rath überführt, Mitglied der Verbrecherorganisation »Die Weiße Hand« zu sein, hatte seinen Arm verloren, war ins Ausland geflohen, ehe ihm der Machtwechsel in Deutschland 1933 das Tor zurück geöffnet hatte. Er gehört mittlerweile zum mächtigen Schwarzen Orden der SS.
Der Oberkommissar Gereon Rath ist seitdem ganz vom Wohlwollen des hasserfüllten Tornow abhängig, seine Position in den nationalsozialistischen Institutionen zunehmend unklar: Offiziell gehört er zum Landeskriminalamt, praktisch hängt er am Gängelband seiner Nemesis. Die Frage, ob sich Rath mit seinem Instrumentarium aus (Halb-)Lügen, Lavieren und Tänzeln am Abgrund wieder aus der Affäre ziehen kann, stellt sich kaum, denn schon in den Romanen Lunapark und Märzgefallene hat diese Überlebensstrategie bestenfalls Schlimmeres verhindert.
Es war nicht das Leben, das er sich ausgesucht hatte, aber wer konnte das schon, zumal in diesen Zeiten. Er konnte froh sein, dass er überhaupt noch eines hatte.
Volker Kutscher: Olympia
Da Olympia mit einem kleinen Prolog aus dem Jahr 1937, von der Handlung aus also ein Stück in der Zukunft liegend, beginnt, weiß der Leser schon, dass einiges in die Brüche geht. Die Olympischen Spiele von 1936, die dem NS-Regime einen Propaganda-Triumph bescherten, haben das Leben eines Mannes grundlegend geändert, wie es heißt. Der hat eine neue Identität angenommen, er arbeitet und lebt in bescheidenen Verhältnissen, zurückgezogen und weit weg von Berlin. Man ahnt, von wem die Rede ist.
Die Vergangenheit ruht jedoch nicht, sie ruht nie. Sie holt den Mann in seinem verdeckten Exil ein. Als er nach getaner Arbeit in seine bescheidene Unterkunft zurückkehrt, sitzt ein Toter in seinem Sessel und eine vertraute Frauenstimme begrüßt ihn. Dieser Spoiler verrät faktisch nichts, reißt vielmehr eine baugrubengroße Leerstelle auf, die der Leser unbedingt gefüllt sehen will; die Spannung schießt sogleich nach oben.
Volker Kutscher hat die Vergangenheit schon in den Romanen ab Die Akte Vaterland fabelhaft in seine Handlung integriert, den Mordfall ganz wunderbar aus zurückliegenden Ereignissen hergeleitet und motiviert. Diesmal bündeln sich die von Rath (und dem Leser) erlebte Vergangenheit in der Handlung, treiben sie voran, bremsen sie aus, lenken die Gedanken und Spurensuchen in Sackgassen und vor allem in die finsteren Abgründe des Dritten Reichs.
Nichts hatte sich verändert.
Volker Kutscher: Olympia
Im Sommer 1936 trifft Gereon Rath diese Feststellung im Nassen Dreieck, einer Kaschemme, deren Interieur so wirkt, wie immer schon. »Immer« meint vor allem die Zeit vor 1933, die Zeit der Weimarer Republik, der oft wankenden, stets auf das Heftigste angefeindeten Demokratie, der am Ende vor allem die Demokraten fehlten. Eine Illusion, wie der im Nassen Dreieck sitzende Gereon Rath weiß.
Dreieinhalb Jahre nach der Machtübergabe an Hitler hat sich nämlich alles verändert. Nicht nur draußen, vor den Scheiben des Nassen Dreiecks, sondern auch bei den Personen, die sich drinnen treffen. Reinhold Gräf, ehemaliger Freund, ehemaliger Polizist, ehemaliger Gestapo-Beamter und mittlerweile Untersturmführer im SD ist der Führungsoffizier des Inoffiziellen Mitarbeiters Gereon Rath, offiziell Oberkommissar im Landeskriminalamt.
Gräf ist also auch eine Art Geist der Vergangenheit, der sich in der Gegenwart zu einem Schreckgespenst gewandelt hat. Der eigentliche Unhold ist jedoch Obersturmführer Tornow, ein deutlich ranghöheres Mitglied der SS als Gräf, der Rath unbarmherzig schurigelt. Spurt der nicht, landet er im Konzentrationslager, das im Roman konsequent mit KL abgekürzt wird; das Schicksal blüht auch der unwissenden Charlotte Rath, das Leben der beiden ist das unter einem (für Charly unsichtbaren) Damoklesschwert.
›Und wenn sie nichts sagt, reichst du sie dann zur Folter an die Gestapo weiter.‹
Volker Kutscher: Olympia
Was KL für deren Insassen bedeutet, warum der Name Gestapo oder die Adresse Prinz-Albrecht-Straße bei allen Menschen in Deutschland, selbst SA- und Parteimitgliedern Angst auslösen, wird dem Leser auf recht drastische Weise vorgeführt. Rath, der ewig Lavierende, instrumentalisiert selbst ein wenig diese Angst, als er an seinem neuen Einsatzort zu verdeckten Ermittlungen eingeschleust wird und die widerspenstigen Kollegen bald glauben, er wäre selbst ein Gestapo-Mann.
Rath ermittelt im Olympischen Dorf, wo ein Todesfall geschieht, der aus politischen Gründen kein Mord sein darf. Der Tote ist ein Amerikaner, Funktionär in der Schwimmmannschaft der USA, die – bedauerlicherweise und nicht zur Nachahmung empfohlen – die Spiele nicht boykottierten. Ein Mord würde den für die Nazis so wichtigen Spiele beschmutzen, deren Propagandawert beeinträchtigen, daher sind diese »Ermittlungen« von Anfang an ein groteskes Irrspiel mit der Wahrheit, politischen Interessen, Machtkämpfen und persönlichem Hass.
Die Polizeiarbeit in Deutschland hat sich 1936 dramatisch verändert. Das »Politische« genießt Vorrang, wie in allen totalitären Regimen wird nicht nach der Wahrheit, sondern nach einer passenden Erzählung gesucht – im Falle des Dritten Reichs lautet ein Leitmotiv: kommunistische Verschwörung. Entsprechend wird nach Verdächtigen gesucht, die brutal verhört werden und in Haft bleiben, wenn sie trotz Gewaltanwendung nichts aussagen und ihre Schuld eigentlich widerlegt ist.
›Ich weiß nur, wenn wir unsere Erkenntnisse an die Behörden weitergeben, dann begehen wir einen Mord.‹
Volker Kutscher: Olympia
Wenn zwingende Gründe auftreten, die der Grundannahme widersprechen, werden diese zurechtgebogen, bis sie mit den Interessen der SS übereinstimmen, oder aber ignoriert bzw. vertuscht, ganz wie es beliebt. So entsteht ein kurioses Hin und Her, das ganz passend den Eindruck einer überwältigenden Willkür und schmerzlicher Ungerechtigkeit erzeugt. Rath ist zu einem Spielball degradiert, obendrein persönlich in das verworrene Mordgeschehen verstrickt.
Sein ehemaliger Ziehsohn Friedrich Thormann (»Fritze«) ist als Ehrendienstler auch im Olympischen Dorf tätig. Sein Interesse gilt einem Autogramm des US-Sprint-Superstars Jesse Owens, dem vierfachen Goldmedaillengewinner bei diesen Spielen, eine Leistung, die angesichts der im Reich gepflegten Lehre von der überlegenen »weißen Rasse« der so genannten »Arier« zu obskuren Lügen und Verschwörungserzählungen zwingt.
Fritze ist Zeuge des Todes, der kein Mord sein darf, und wird in den Fall und dessen lebensgefährlichen Wirrnisse hineingezogen, hinter denen tatsächlich eine Verschwörung steht, aber eine ganz andere, als gedacht. Auch Charly steht unter Druck, sie arbeitet mit Ex-Polizist Böhm heimlich als Fluchthelferin. In Olympia kommen diese Formen des Durchwurstelns im »Dritten Reich« an ihre Grenze, Kutscher zwingt seine Helden dazu, sich den Tatsachen, so schmerzlich sie auch sind, zu stellen.
›Oberkommissar Rath ist zu einem Risiko für Deutschlands Sicherheit geworden. Er muss beseitigt werden.‹
Volker Kutscher: Olympia
Gegen Ende des Romans überspannt Volker Kutscher den Bogen für meinen Geschmack ein wenig. Sowohl die Auflösung der Todesfälle als auch der Showdown sind nicht so gelungen, wie in den anderen Romanen. Gewünscht hätte ich mir auch eine spürbare Entwicklung von Charlotte Rath, die noch immer aus einer sehr spontanen, fast naiven Haltung heraus agiert, was angesichts ihrer Klugheit und des langen Weges, den sie von der Stenotypistin zur Fluchthelferin zurückgelegt hat, nicht recht passen will.
Das ist ein kleiner Wermutstropfen angesichts der großen, sich zuspitzenden Spannung, von der die Handlung in diesem Roman getragen wird. Die vielen Wendungen, groß und klein, die meisten Entscheidungen der Personen, sind sehr gut motiviert. Das Ende oder: die Enden sind wie Türen in den folgenden Band, den man gleich im Anschluss lesen möchte.
Vor allem mochte ich das große Bild, das gezeichnet wird, die Atmosphäre, als läge Berlin unter einer Winternacht: In einem Unrechtsstaat kann niemand anständig bleiben, Wegducken, Mitlaufen, selbst williges Mitschwimmen und Mittun im Strom kann – wenn der Zufall es will – verheerende Folgen zeitigen. Vor derlei Unbill schützt nur das Recht im Rechtsstaat, ist der erst einmal geschleift worden, ist es zu spät.
Weitere Romane der Buchreihe:
Volker Kutscher: Die Akte Vaterland.
Volker Kutscher: Märzgefallene.
Volker Kutscher: Lunapark.
Volker Kutscher: Marlow.
Volker Kutscher: Transatlantik.
Volker Kutscher: Olympia
Piper 2020
Gebunden 544 Seiten,
ISBN: 9783492070591