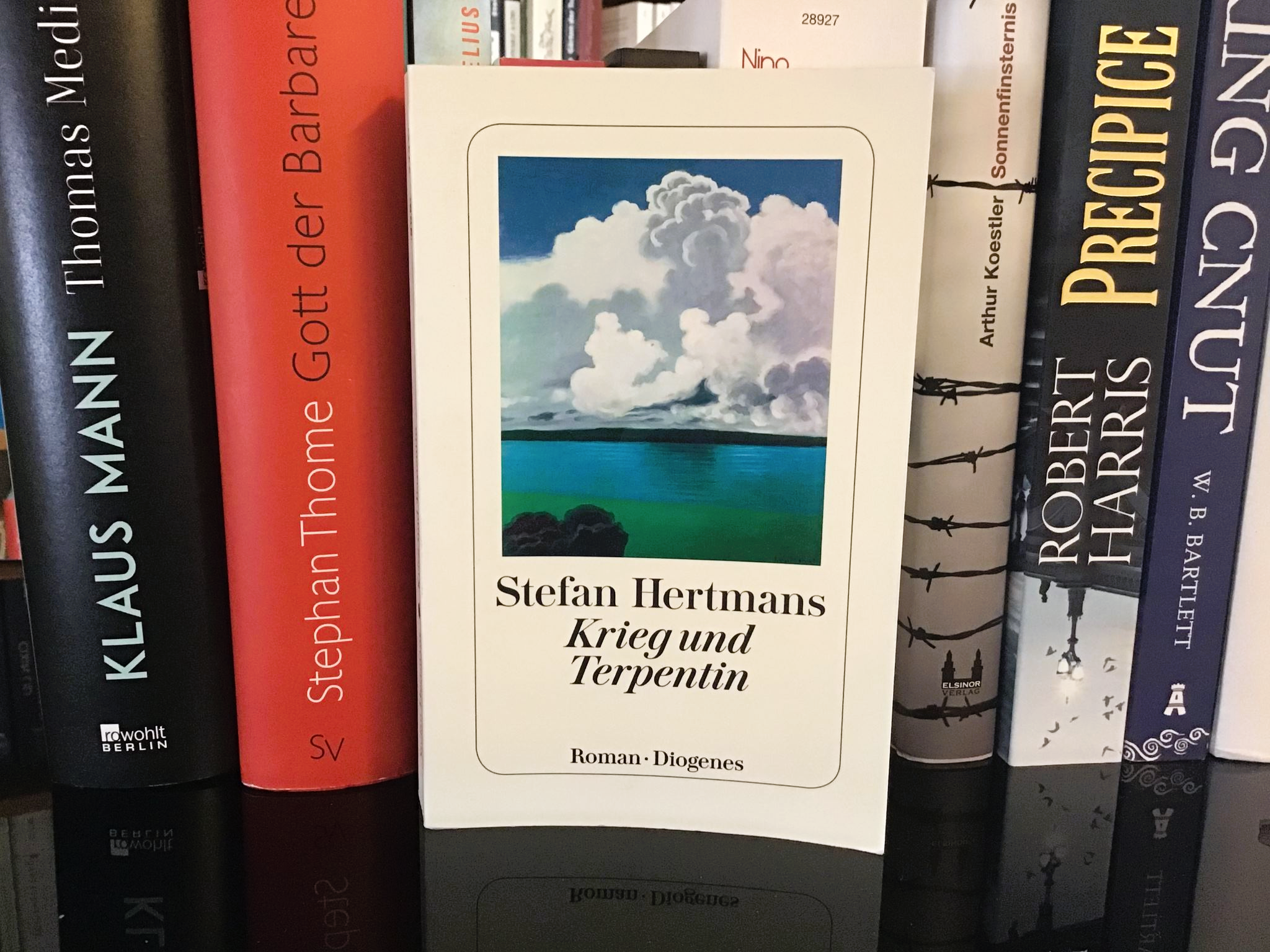Das Cover, nein das Cover ist nicht so eines. Es kündigt nicht eines jener Bücher an, die mit einer Frau im Vordergrund, halb oder ganz abgewandt und damit zumeist einer helleren Zukunft entgegenblickend die Regale unter dem Label »Historische Romane« füllen. Wild (wie die bewegte See), ja, romantisch auch, aber nicht in abgeschmacktem Sinne; dramatisch, auf jeden Fall, wenn auch ohne die genreübliche Action. Spannend: von ersten bis zum letzten Augenblick.
Die Hauptfigur von Die Korrektur der Vergangenheit ist ohnehin keine Frau, sondern ein gewisser John Lacroix, der sich in den Spanienfeldzug des Jahres 1808/09 gestürzt hat und von diesem an Körper und Geist zerschunden wieder ausgespien wurde. Sein Weg zurück aus der Dunkelheit im Vorraum des Todes zurück ans Licht, das von Erinnerungen und Scham verdüsterten Licht des Lebens.
Unter den Händen von Nell, der Haushälterin, kann Lacroix genesen, doch die inneren Verwüstungen trägt er mit sich herum; sie lassen ihn gar an Selbstmord denken. Um welche es sich handelt, erfahren wir nicht von ihm, jedenfalls nicht am Anfang. Der britische Feldzug in Spanien endete mit einem katastrophalen Rückzug, mehr als die kargen Äußerungen, über die man auch flüchtig hinweglesen könnte, gibt es nicht.
Man ahnt jedoch eine Menge. Der Offizier einer Kavallerieeinheit kommt in einem völlig abgerissenen Zustand zurück. Seine Ausrüstung, seine Waffen, die meiste Kleidung und seine Stiefel sind verschwunden, statt seiner Truhe und Taschen führt er nur einen billigen Tornister mit sich. Immerhin lebt er, sein Gehör hat gelitten, was während der gesamten Handlung immer wieder geschickt eingeflochten wird, um das Motiv des Verstehens durchzuspielen.
Der Krieg ist jedoch nicht vorbei, England schickt wieder Streitkräfte nach Spanien, plötzlich sieht sich Lacroix mit der Aussicht konfrontiert, noch einmal in die Hölle zurückkehren zu müssen. Er beschließt, seinen aktiven Dienst zu beenden und nach Norden zu fahren – mit einem Wort: Er desertiert (mehr oder weniger).
Dass auch Soldaten dagewesen wären, Rückkehrer aus Spanien, die einfach auf der Straße lagen ohne Augen und Beine.
Andrew Miller: Die Korrektur der Vergangenheit
Es hätte für Lacroix also auch schlimmer kommen können – die Versuchung, das zu sagen, liegt nahe; was dieser Krieg zwischen englischen und französischen Truppen sowie spanischen Einheiten und Freischärlern, ausgefochten auf spanischem Boden für Lacroix mit sich brachte, erfährt der Leser aus einer anderen Perspektive. Die Wechsel der Erzählsicht, von Ort und Zeit und Personen, gehören zu den herausragenden Stärken von Autor Andrew Miller.
Die so entstehenden Auslassungen, offenen Fragen, Vermutungen und leeren Stellen lassen das drängende Bedürfnis nach Antworten, Erhellung, Aufklärung entstehen – bis zum Ende des Romans und darüber hinaus. So erfährt der Leser, dass Lacroix mit einem Geschehnis in Verbindung gebracht wird, das man getrost als Kriegsverbrechen bezeichnen kann.
Ob und inwieweit das in seiner Verantwortung lag bzw. die Aussagen, die darüber in einer großartigen Passage vorgetragen und zusammengestellt werden, überhaupt eine Anschuldigung, gar nicht zu reden von einem Prozess oder Verurteilung ausreichen würden, bleibt anfangs völlig offen. Es ist aber Krieg und dessen totaler Charakter lässt in der Regel alles Recht verbleichen, wenn nicht gar verschwinden.
Im Parallelogramm der Kräfte steht England gegen Frankreich und damit gegen einen übermächtigen Feind, der gerade Preußen und Österreich militärisch zermalmt hat. England braucht Spanien und die »Spanier wollen einen Schuldigen« für ein Vorkommnis während des Feldzuges, woraus sich eine hübsche, wenn auch etwas konstruierte geopolitische Notwendigkeit für eine abseits des Rechts durchzuführende Bestrafungsaktion ergibt.
›Ich bin der Krieg. Ja? Und heute ist der Krieg zu Ihnen gekommen. Er ist direkt in Ihr Haus gekommen und hat sie niedergeschlagen.‹
Andrew Miller: Die Korrektur der Vergangenheit
Der Krieg macht nicht jeden so fertig wie Lacroix, manche werden mit ihm und seinen Zudringlichkeiten fertig, werden ein Teil von ihm und machen diesen zu einem Teil von sich. Den Krieg tragen sie im Tornister ihrer Persönlichkeit, wenn sie in die Heimat zurückkehren. In diesem Fall mit einem heiklen Auftrag, bei dessen Ausführung der Beauftragte namens Calley bedenkenlos zu Gewalt greift. Das Zitat trifft das ganz wunderbar und liefert die kalte Rechtfertigung durch Selbstdistanzierung – es wäre »Der Krieg« – gleich mit.
Der politisch motivierte Auftrag erfordert wegen der nötigen Abwesenheit von Recht und Öffentlichkeit die Anwesenheit eines Zeugen, so bildet sich ein Buddy-Paar, der Engländer Calley und der Spanier Medina, die sich auf den Weg nach Großbritannien machen und ihrer Zielperson nachspüren, die bestraft werden soll. Auf dem Weg quer durch das Land werden sie – wie auch der Leser – Zeuge der unaufhörlich voranschreitenden Industrialisierung der Insel.
In beklemmenden Szenen wird geschildert, wie es innerhalb der Mauern dieser Gebäude, »groß wie eine Kaserne, in dem Arbeit vonstattenging, die die Lohnsklaverei der Massen war«. Diese Welt des »Fortschritts« entpuppt sich als menschenverachtende Stätte der Ausbeutung mit brutalsten Mitteln; Calley, »der Krieg«, hat als Kind dort seine Prägung erhalten; die Armee hat diese Anlagen verschärft, ihn zu einem erbarmungslosen und dank der in Aussicht gestellten Belohnung zielstrebigen Jäger gemacht.
Empfand Calley wie er selbst? Dass sie Narren auf einem Narrengang waren?
Andrew Miller: Die Korrektur der Vergangenheit
Sein Partner ist anders, Medina ist das Unbehagen oft anzumerken. Er denkt viel über seinen englischen Partner und ihren Auftrag nach, stellt ihn in Frage und malt sich immer wieder aus, wie er dieser Jagd, die er als »Narrengang« empfindet, entkommen könnte.
Die Verfolgung ist trotz mangelnder Action hochspannend gestaltet, die beiden Parteien wählen ganz unterschiedliche Routen. Miller gestattet seinem Helden und seinen beiden Häschern eine vorzeitige Begegnung, denn die drei Personen befinden sich einmal zufällig am gleichen Ort – sie erkennen sich dank sorgsam gestalteter Umstände nicht.
Das ist einmal hochspannend, außerdem nutzt der Autor es für eine kleine Erzählfinte: Lacroix findet auf dem Tisch in seinem Gastzimmer, das er immer mal wieder mit einem anderen Gast teilen muss, das Wort »NADA«, auf Spanisch heißt das »Nichts«. Er kann sich darauf keinen Reim machen, der Leser schon, einen ziemlich umfassenden sogar, angesichts dessen, was er bis dahin schon weiß.
Für Lacroix hingegen hat das Wort »NADA« in diesem Moment eine ganz andere Bedeutung im Sinne einer bedeutungsschwangeren Zeichens: Er hat im Norden neue Menschen kennengelernt, darunter Emily, die ein Augenleiden hat, das sie erblinden lässt. Eine durchaus gefährliche Operation könnte Abhilfe schaffen oder schwerwiegende Folgen haben.
Natürlich kommt er, der Augenblick, das sich das »NADA« in »ALGO« verwandelt, die Stunde der Wahrheit. Mehr aber werde ich hier nicht verraten, denn Die Korrektur der Vergangenheit ist bei allem anderen auch wegen der lange offengehaltenen Leerstellen ein ungeheurer Lesespaß und Genuss. Ein Fest mit einem hochdramatischen Showdown und einem Schlusskapitel, dessen Sinn sich erst mit Blick auf den Originaltitel (Now We Shall Be Entirely Free) erschließt.
Hilary Mantel kann in ihrem Lob, »Millers Schreiben sei eine Quelle des Staunens und der Freude«, nur nachdrücklich zugestimmt werden.
[Rezensionsexemplar]
Andrew Miller: Die Korrektur der Vergangenheit
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl
Paul Zsolnay Verlag 2023
Gebunden 480 Seiten
ISBN: 978-3-552-07338-8