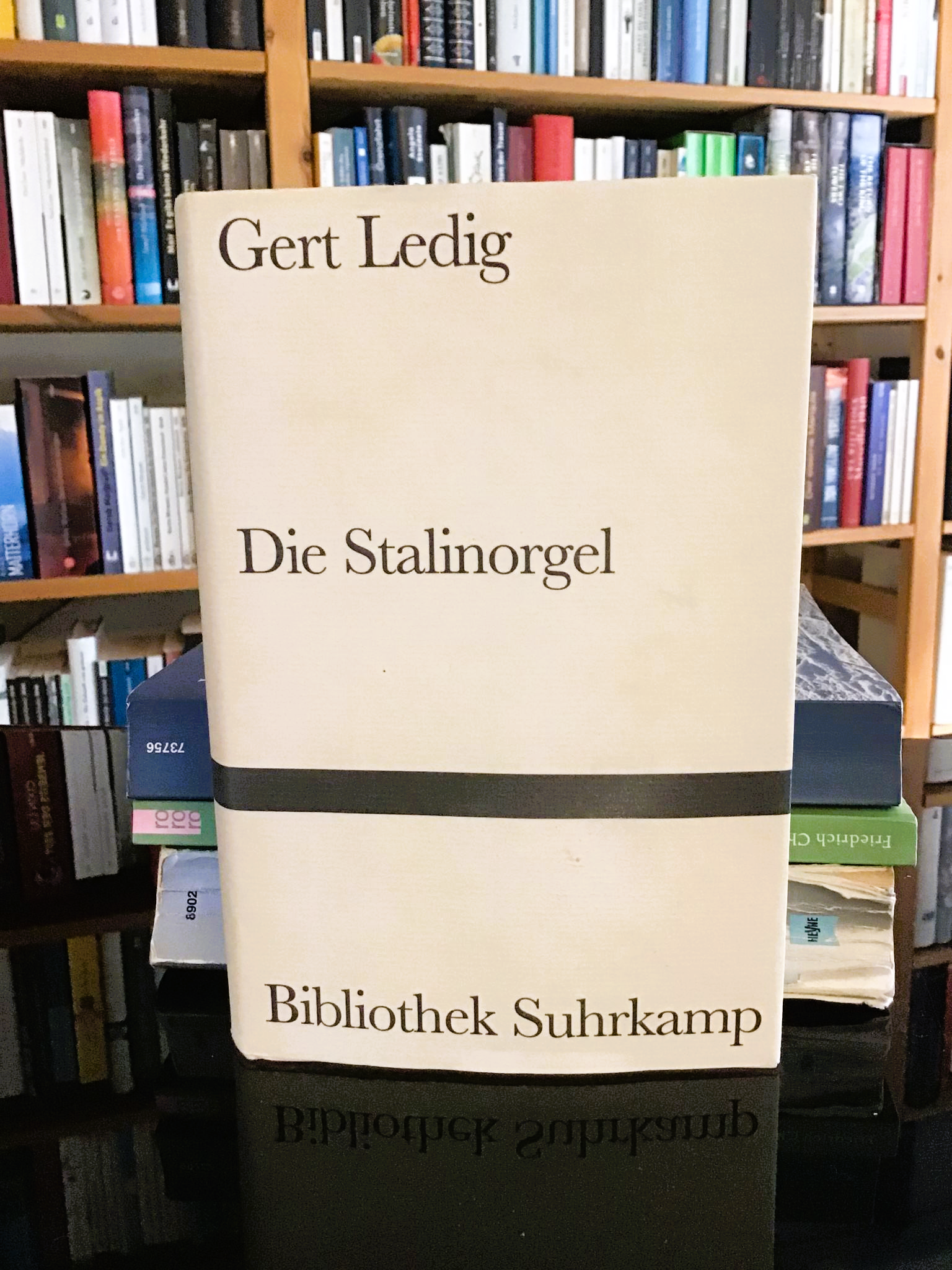Es ist nur ein schmales Büchlein, das man in wenigen Stunden lesen kann. Und doch ist Éric Vuillard mit seinem Buch Die Tagesordnung ein Streich gelungen, für den er mit dem Prix Goncourt, dem wichtigsten französischen Literaturpreis, ausgezeichnet worden ist. Ein Roman ist es nicht, jedenfalls nicht im überkommenen Sinne der Literaturbürokratie.
Der Autor hat einen scharfen Blick für Szenen und ein Talent, diese mit anderen zu kombinieren, woraus sich ein Zugang zur Vergangenheit ergibt, der in gewöhnlichen Geschichtsbüchern fehlt. Mängel werden so gnadenlos ans Tageslicht gefördert, bloßgestellt und von Vuillard mit einer bemerkenswerten Boshaftigkeit vor dem Leser ausgebreitet.
Den Anfang der Tagesordnung bildet eine Zusammenkunft von einflussreichen Industriellen und Finanzleuten mit Göring und Hitler kurz nach der Machtübergabe an den selbsternannten Führer im Februar 1933. Vuillard schildert das Eintreffen mächtiger Männer, um sie etwas später in Geister zu verwandeln, hinter denen die überdauernden Firmen stehen: Allianz, Opel, Siemens, BASF, Bayer. Die Botschaft: Es geht um die Gegenwart, die aus der Geschichte entstanden ist.
Die Herren zahlen ordentlich in die Kasse der Nazipartei, die im März 1933 einen Wahlkampf zu gewinnen hat, um Wahlen für die nächsten Jahre, Jahrzehnte zu unterbinden. Diese Ankündigung trifft auf Wohlwollen, man zahlt und – der Nachgeborene weiß es – bereitet damit auch den Weg in den Untergang von Millionen Menschen, Städten und Landstrichen. Die Firmen, die sie vertreten, überdauern. Man mag die Art der Darstellung mögen oder auch nicht. Legitim ist es.
Man musste nur ein paar belanglose Millimeter, ein kleines Stückchen Wahrheit, abschneiden, um den österreichischen Bundeskanzler seriöser und nicht so verdattert wie auf der ursprünglichen Aufnahme dreinschauen zu lassen; ganz so als verleihe die Tatsache, dass man das Bildfeld etwas eingeengt, ein paar überflüssige Elemente getilgt und die Aufmerksamkeit auf ihn konzentriert hatte, Schuschnigg mehr Substanz. Nichts ist unschuldig in der Kunst des Erzählens.
Eric Vuillard: Die Tagesordnung
Ein grundsätzliches Problem von Geschichte besteht darin, dass sie mit Geschichtsschreibung und – überlieferung gleichgesetzt wird. Wer also von historischer »Wahrheit« in welcher Form auch immer fabuliert, hat die Grenze zur Lüge bereits überschritten. Das Zitat macht das schön deutlich, Vuillard bringt weitere Beispiele sanft, aber wirkungsmächtig manipulierter »Quellen«.
Denn Historiographie ist naturgemäß rückblickend, selbst wenn man über etwas berichtet, was man selbst erlebt hat. Es schiebt sich immer etwas zwischen Erleben und Berichten, Niederschreiben und Weitergeben, erst recht, wenn es um die Darstellung vergangener Begebenheiten durch Historiker geht.
Der Rückblickende schaut durch andere Ereignisse hindurch. Wer heute zum Beispiel etwas über das Jahr 1938 schreibt, hat immer den Verlauf des Zweiten Weltkrieges im Kopf. Es ist unmöglich, sich naiv zu stellen und so zu tun, als wüsste man nichts davon, wie zum Beispiel die Wehrmacht im Jahr 1940 Frankreich zermalmt hat, mit einem Feldzug, der »Blitzkrieg« genannt wird.
Am Vormittag des 12. März erwarten die Österreicher fieberhaft und mit unanständigem Frohlocken das Eintreffen der Nazis. […] Doch die Deutschen lassen auf sich warten.
Eric Vuillard: Die Tagesordnung
Das hat eine kuriose Vorgeschichte, die schlaglichtartig beleuchtet, wie problematisch solche Begriffe á la »Blitzkrieg« sind. Wenn es um die Kriegsdrohung des Reiches gegenüber Österreich vor dem so genannten »Anschluss« geht, wird diese Begrifflichkeit ernstgenommen. Vuillard aber zeigt, dass der Einmarsch der Wehrmacht in Österreich ein Panzerstau gewesen ist – das Gegenteil von »Blitzkrieg«.
Der »Bluff«, die mafiöse Drohung und die Skrupel der Gegner haben den Weg bereitet, nicht unbesiegbare Kampfpanzer – die zu diesem Zeitpunkt eher anfälligen Dosen als gefürchteten Panther, Tiger und Königstiger ähnelten. Von einem richtigen »Blitzkrieg« wie 1940 gegen Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg konnte also gar keine Rede sein.
Was an diesem Krieg verblüfft, ist der unerhörte Erfolg der Frechheit, der uns eines lehren sollte: Die Welt gehorcht dem Bluff.
Eric Vuillard: Die Tagesordnung
Die Aktualität ist niederschmetternd! Wer denkt nicht an die Ukraine und Putins Spielchen? Wer denkt nicht an das unglaubliche Versagen der Westmächte, England und Frankreich, die von Vuillard genauso erbarmungslos vorgeführt werden?
Sein englischer Schriftstellerkollege Robert Harris geht mit Chamberlain sehr viel zurückhaltender um, in seinem Roman Munich wird aber das Prinzip des Bluffs ebenfalls wunderbar in Szene gesetzt, wenn eine deutsche Panzerdivision durch die Straßen rollt, allein zum Zwecke der Einschüchterung; es funktionierte abermals!
Vor allem anderen aber überdauern die verlogenen Bilder vom Krieg. Vuillard findet dafür starke Worte, doch sie sind mehr als berechtigt. Denn die Filme über den Westfeldzug 1940 zeigten gar keine Bilder von der Front – das war schlechterdings nicht möglich, denn zwischen Filmen und Zeigen (in der Wochenschau im Kino) verging einige Zeit. Was also sollte man zeigen, als es losging? Aufnahmen von Manövern! Inszeniertes Kriegstheater.
Die Geschichte entrollt sich vor unseren Augen wie ein Film von Josef Goebbels.
Eric Vuillard
Goebbels Wochenschauen haben eine Illusion erzeugt, die bis heute prägend gewesen ist. Die Pannenarmee auf dem Weg nach Wien 1938 sah auf den Leinwänden aus wie eine nicht aufzuhaltende Maschine, während in Wirklichkeit die Schwächen immens waren; auch ein halbes Jahr später, anlässlich der Konferenz von München. Doch das mag keiner mehr sehen, weil die Filme eine andere Wirklichkeit in die Köpfe implantiert haben. 1940 ist die Wehrmacht selbstverständlich aufhaltbar gewesen, nur ihre Gegner haben sich maximal blamiert.
Ihren Anteil an der historischen Balkenbiegerei haben auch amerikanische Filmstudios. Vuillard überhäuft Hollywood mit schwerwiegenden Vorwürfen. Das ist etwas ungerecht, denn wer sich im Genre des Kriegsfilms umschaut, wird selten wirklich gute Streifen sehen, die dem Prinzip des Heldentums nicht huldigen und zwar unabhängig vom Entstehungsland.
Die große amerikanische Maschine schien sich bereits seines ungeheuren Aufruhrs bemächtigt zu haben. Sie sollte den Krieg ausschließlich als Heldentat darstellen.
Eric Vuillard: Die TAgesordnung
Natürlich stehen Filmemacher vor einem gewissen Dilemma. Wer mag schon die Realität abbilden, wenn die filmische Magerkost verheißt? Der amerikanische General Patton hat einmal die Artillerie als kriegsentscheidend bezeichnet. Sie wollen einen Spielfilm darüber drehen? Dann viel Vergnügen beim Finanzieren!
Zu den ohnehin nicht wenigen Treppenwitzen der Weltgeschichte gehört, dass ausgerechnet deutsche Kriegsfilme das Heldentum-Narrativ oft brechen und ein brutales Kriegserlebnis zeigen. Goebbels’ Epigonen haben sich von seiner Schilderung des Krieges gelöst und sind – noch – nicht auf das global wirkmächtige Erzählen eingeschwenkt.
Es ist schon erstaunlich, amerikanisches Filmpublikum beim Betrachten von Das Boot zu beobachten, die betroffene Stille, die sich senkt, wenn die Kamera am Ende über die Gesichter der Toten fährt. Die Erwartungen, eingepflanzt durch die schier endlose Kette an Helden-Kriegsfilmen, wird bei diesem Finale enttäuscht und erwischt den Zuschauer auf dem ungewohnten Fuß.
Ein Roman ist „Die Tagesordnung“ nicht, ein historiographisches Werk auch nicht. Es ist eine fiktionalisierte historische Montage, widerborstig in Anordnung und boshaft direkt in der Sprache, was den Leser zum Nachdenken über bequeme, falsche Gewissheiten zwingt. Die Kenntnis der historischen Vorgänge erleichtert das Lesen und das Nachvollziehen der Gedanken ungemein, ist aber keine unabdingbare Voraussetzung.
Eine sehr schöne Buchbesprechung, die einen anderen Schwerpunkt wählt, findet sich bei Literaturreich. Den Begriff »kondensierte Geschichte« finde ich sehr passend!
Éric Vuillard: Die Tagesordnung
Aus dem Französischen von Nicola Denis
Matthes & Seitz 2018
Gebunden 128 Seiten
ISBN: 978-3-95757-576-0