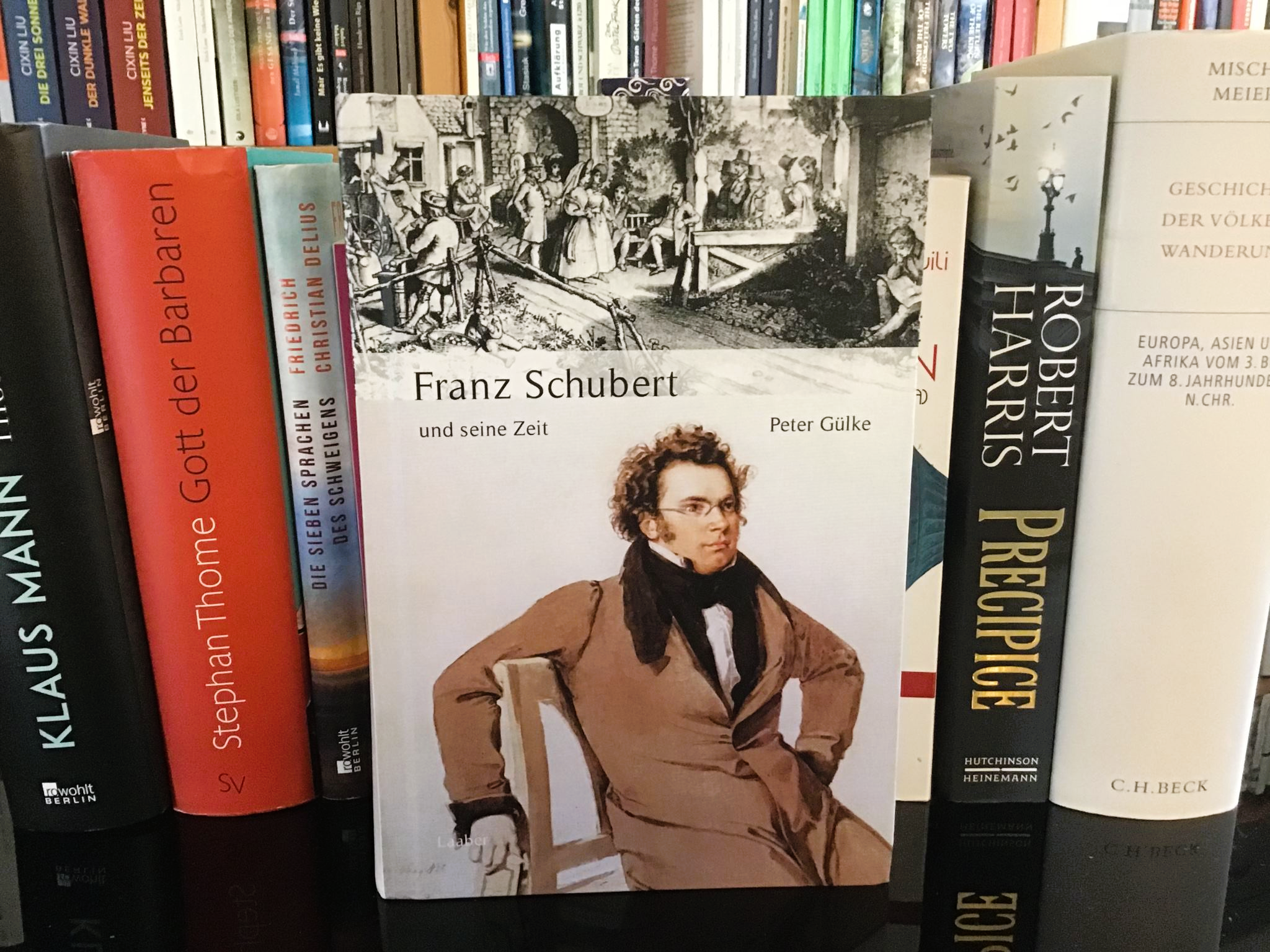Die südfranzösische Stadt Marseille platzte im Sommer 1940 aus allen Nähten. Zu den 900.000 Bewohnern aus der Vorkriegszeit kam noch eine halbe Million Menschen hinzu, die man etwas despektierlich als Treibgut des Krieges bezeichnen könnte: Flüchtlinge aus vielen europäischen Ländern, britische Soldaten, Fremdenlegionäre, Angehörige der französischen Kolonialtruppen (Algerien, Indochina, Marokko), demobilisierte Franzosen.
Es war ein buntes Gewirr des Schreckens, denn das exotische Gemenge der Kleidung überdeckte nicht die pure Not der Gestrandeten, von denen die überwältigende Mehrheit vor allem eines wollte: raus aus Frankreich, weg vom Krieg. Die Wehrmacht hatte Frankreich, die Niederlande, Belgien und Luxemburg innerhalb weniger Wochen überrollt und Millionen fliehende Menschen wie eine Bugwelle vor sich hergetrieben. Aus französischer Sicht hat Pierre Lemaitre diese Zeit in seinem brillanten Roman Der Spiegel unseres Schmerzes beschrieben.
Zu den Flüchtlingen gehörte eine recht kleine Schar deutschsprachiger Literaten, die nach 1933 aus Deutschland (später auch Österreich und der Tschechoslowakei) fliehen mussten, also schon die zweite oder dritte Flucht durchlitten. Ihnen widmet sich Uwe Wittstock in seinem Buch Marseille 1940, ohne dabei zu unterschlagen, dass es sich nur um die sprichwörtliche sichtbare Spitze des Eisbergs handelt: Die prominenten Literaten ließen Spuren in Form schriftlicher Zeugnisse, die überwältigende Mehrheit der vor dem Nazi-Terror Fliehenden nicht.
Vor den Augen Amerikas bricht eine Nation zusammen, die als Inbegriff der Zivilisation, Aufklärung, Eleganz und Lebensfreude gilt.
Uwe Wittstock: Marseille 1940
Es ist gut, dass Wittstock gleich zu Beginn deutlich macht, wem er sich – mangels überlieferter Materialien – zwangsläufig nicht widmen kann (hier sei auf den Roman Die Nacht von Lissabon von Erich Maria Remarque verwiesen). Der Fokus auf literarische Prominenz kann das Bild durchaus verzerren, denn einige Literaten konnten immerhin auf ihre Bekanntheit, eine gewisse Vernetzung und Hilfe von außen hoffen. Die gewöhnliche Zeitgenossen hatten wenig Aussicht, die Aufmerksamkeit der First Lady in den USA, Eleanor Roosevelts, zu erhalten, wie etwa Lion Feuchtwanger.
Genutzt hat es ihm im gewissen Rahmen, doch die restriktiven Rahmenbedingungen für Fliehende ließen sich selbst in diesem Fall nicht außer Kraft setzten – in allen anderen Fällen auch nicht. Es sind Motive, die auch in der Gegenwart die so genannte Flüchtlingsdebatte beherrschen und schwer erträglich machen. Ganz vorn dabei: Bürokratie. Aber auch einander widersprechende Aktivitäten vor Ort, wenn Botschafts- und Konsulatsangehörige Anträge verschleppen, blockieren, während gleichzeitig andere als hilfreiche Wegbereiter auftreten.
Die Lage im Marseille 1940 war politisch und rechtlich kompliziert. Der größte Teil Frankreichs war von der Wehrmacht okkupiert, bis Ende 1942 blieb ein gewisses Gebiet unter der Kontrolle eines ultrakonservativen, rechten Regimes unter Petain. Von diesen hatten Fliehende, vor allem Kommunisten und Juden, wenig Gegenliebe zu erwarten, dank deutschen Drucks galt das für alle, die in Hitlers Deutschland als Staatsfeinde angesehen wurden. Vichy-Frankreich war bis Ende 1942 eine seltsame Zwischenwelt, nicht frei, aber eben auch noch nicht unter der direkten Zuchtrute des „Dritten Reichs“.
Da Italien an der Seite Deutschlands in den Krieg eingetreten war und Spanien zwar neutral, aber durch das rechte Franco-Regime nur bedingt eine Fluchtoption, blieb vor allem Portugal als Ziel, das nur unter großen Schwierigkeiten und Gefahren zu erreichen war. Welche haarsträubenden, dramatischen und durchaus tragischen Schicksale diese geopolitische Zwangslage der in Südfrankreichs Metropole angespülten Flüchtlinge heraufbeschwor, schildert Marseille 1940 in einer mitreißenden Weise, die den Leser rasch gefangen nimmt.
Eine ganze Generation europäischer Kulturgrößen droht innerhalb der nächsten Wochen ermordet zu werden.
Uwe Wittstock: Marseille 1940
Dazu trägt auch der besondere Montage-Stil bei, den Wittstock bereits in Februar 33 verwendet hat. Neben den stets wechselnden Perspektiven, die insgesamt aber die alles umstürzende Gewalt des „Blitzkrieges“ abbilden, werden einzelne Passagen eingestreut, die schlaglichtartig erhellen, welche Art Krieg von den deutschen bewaffneten Verbänden auch im Westen geführt wurde. Die Erschießung von dunkelhäutigen Soldaten der französischen Streitkräfte nach deren Kapitulation etwa, ein Kriegsverbrechen, das historisch im Schatten der millionenfachen Verbrechen im Osten steht. Durch diese Passagen wird die Lebensgefahr für die vielen Flüchtlinge unterstrichen – das “Dritte Reich“ exekutierte seine Ideologie gnadenlos.
„Blitzkrieg“ ist ein wichtiges Stichwort: Wenn wir Bilder vom Krieg sehen, ist es allzu oft Propaganda aus Goebbels Filmschmieden des “Dritten Reichs“. Éric Vuillard hat in seinem Buch Die Tagesordnung darauf hingewiesen, auch gibt es Dokumentationen, die offenbaren, dass in den deutschen Wochenschauen Aufnahmen gezeigt wurden, die vor den Ereignissen (wie dem Angriff auf Frankreich) gedreht wurden. Um Aktualität vorzuschützen, wurden diese in den Kinos mit den entsprechenden Worten umgedeutet; bis heute prägen sie aber unser Bild vom „Blitzkrieg“ im Westen, der mit dem tatsächlichen Krieg wenig zu tun hat.
Bücher wie Marseille 1940 sind auch deswegen so wertvoll, weil sie die sauberen Propaganda-Bilder Lügen strafen und den Blick auf eine ganz andere, brutalere, grausamere Wirklichkeit voller Verzweiflung, Todesnot und tiefer Abgründe freigeben. Das gilt auch für die Behandlung von Flüchtlingen in Frankreich, die dort interniert wurden. Der Zweite Weltkrieg war auch ein Krieg der Lager, in fast jedem Land (selbst den USA, wie David Gutersons Roman Schnee, der auf Zedern fällt am Beispiel japanischstämmiger Amerikaner zeigt) gab es sie.
Zwar sind sie in Frankreich keine Konzentrations- oder gar Vernichtungslager gewesen, doch die haarsträubenden hygienischen Verhältnisse, die unzureichende Versorgung und die bedrückende Unsicherheit machten aus ihnen kleine Höllen für die Insassen. Doch viele Verhaltensweisen der Gefangenen, aber auch des Wachpersonals sind seltsam vertraut aus der vielfältigen Lagerliteratur. Besonders musste ich an Hannah Arendt denken und ihren recht eigenmächtigen Umgang mit der Lage, aber auch an die Franzosen, die sich unter bestimmten Umständen ebenfalls in Internierungslagern wiederfanden.
Ihre Zusammenkünfte wirken dann wie bittere Parodien auf jene Künstlertreffs, die seinerzeit in Pariser Café du Dôme oder in Romanischen Café in Berlin stattfanden.
Uwe Wittstock: Marseille 1940
Bemerkenswert ist ein Umstand, den man getrost als Grundkonstante des Fliehens und des Engagements für Flüchtlinge bezeichnen könnte: Illegalität. Man kennt dieses Wort aus zahllosen Politiker-Reden der Gegenwart. Eine der wichtigsten Personen in Marseille 1940, die ich bislang noch gar nicht erwähnt habe, hat im Kern eine Organisation initiiert und vor Ort geführt, die man getrost als illegale Fassadenfirma einer Fluchthilfe-Gesellschaft bezeichnen könnte. Historisch ist diese Form des Gesetzesbruch heroisch, doch wie würde Varian Fry wohl in der Gegenwart gesehen werden?
[Rezensionsexemplar]
Uwe Wittstock: Marseille 1940
Die große Flucht der Literatur
C.H. Beck-Verlag 2024
Hardcover 351 Seiten
mit 28 Abbildungen und 2 Karten
ISBN: 978-3-406-81490-7